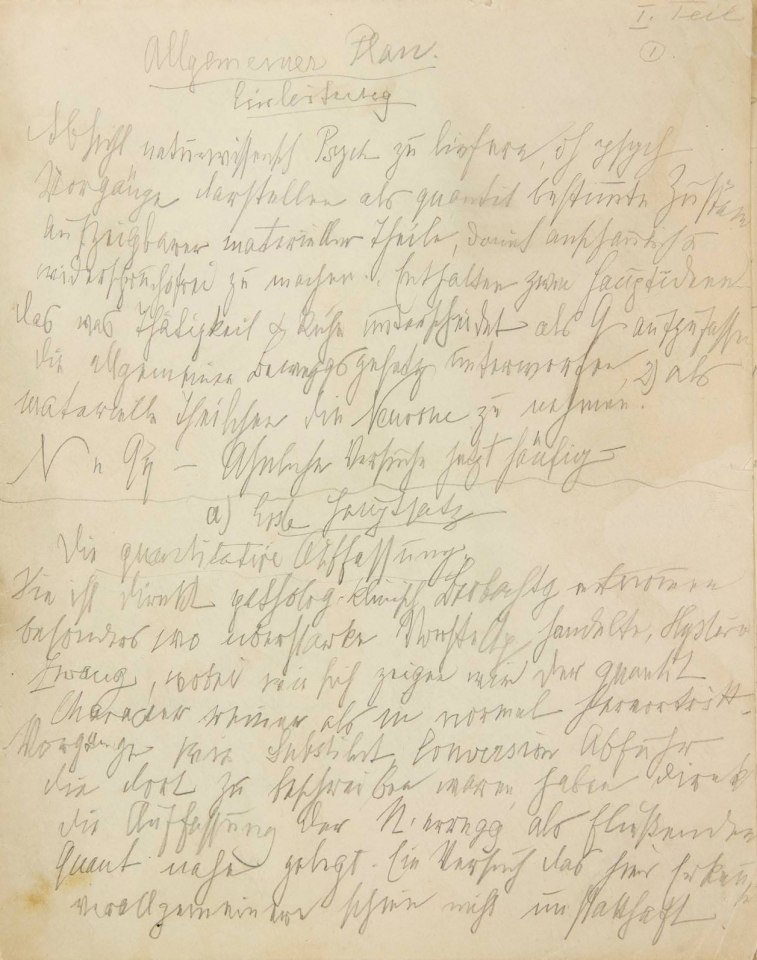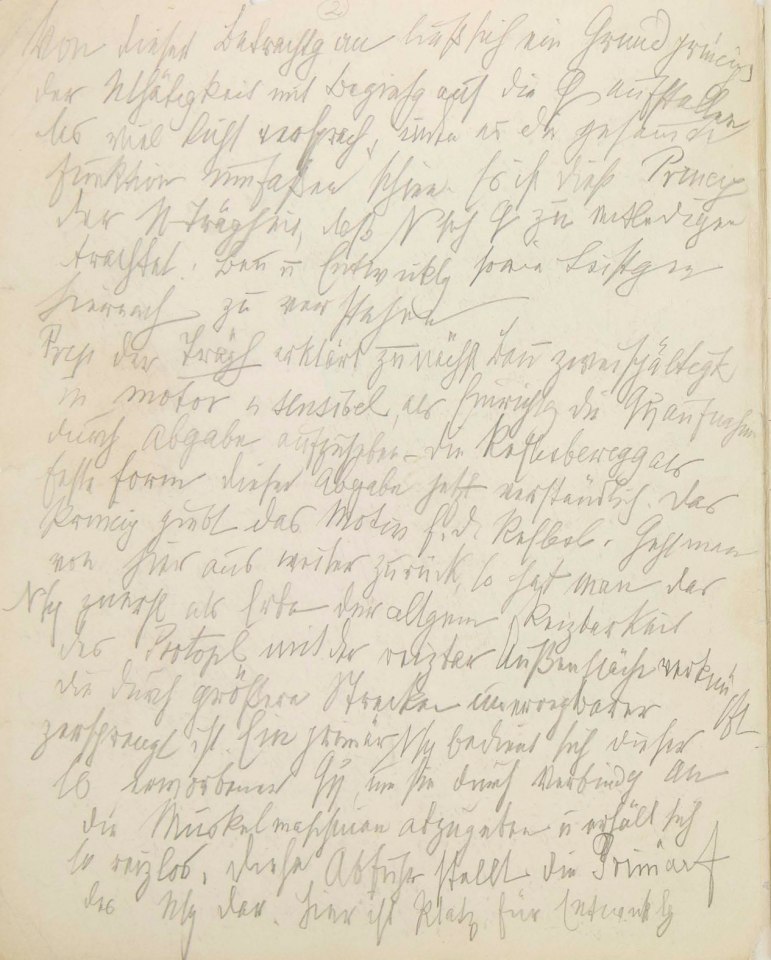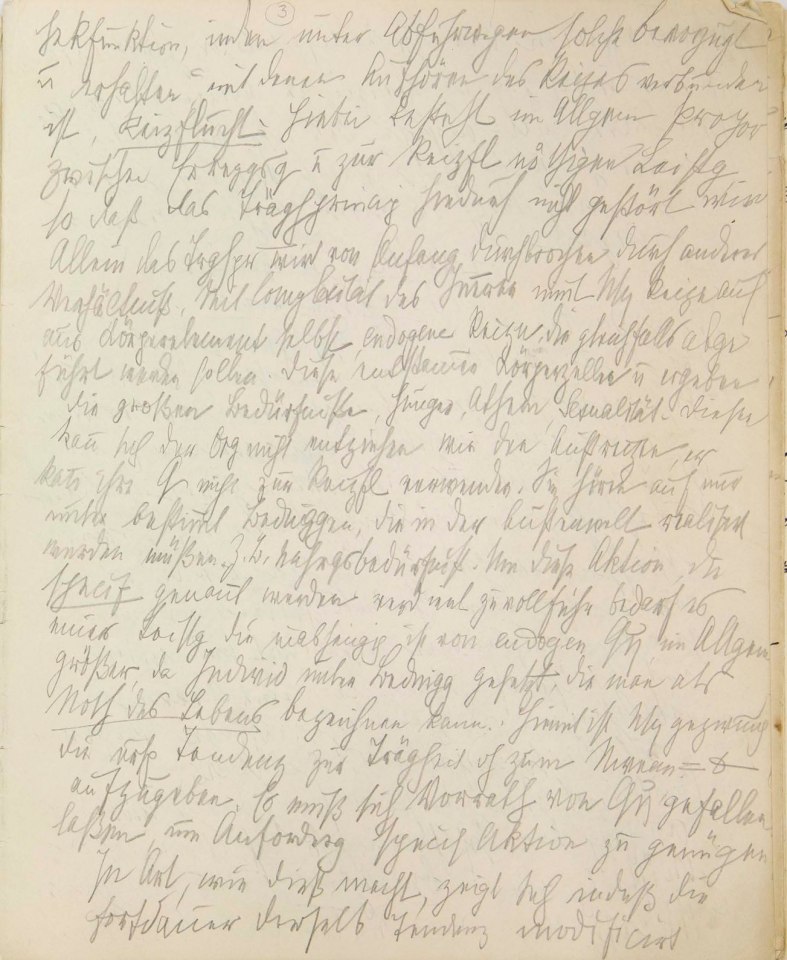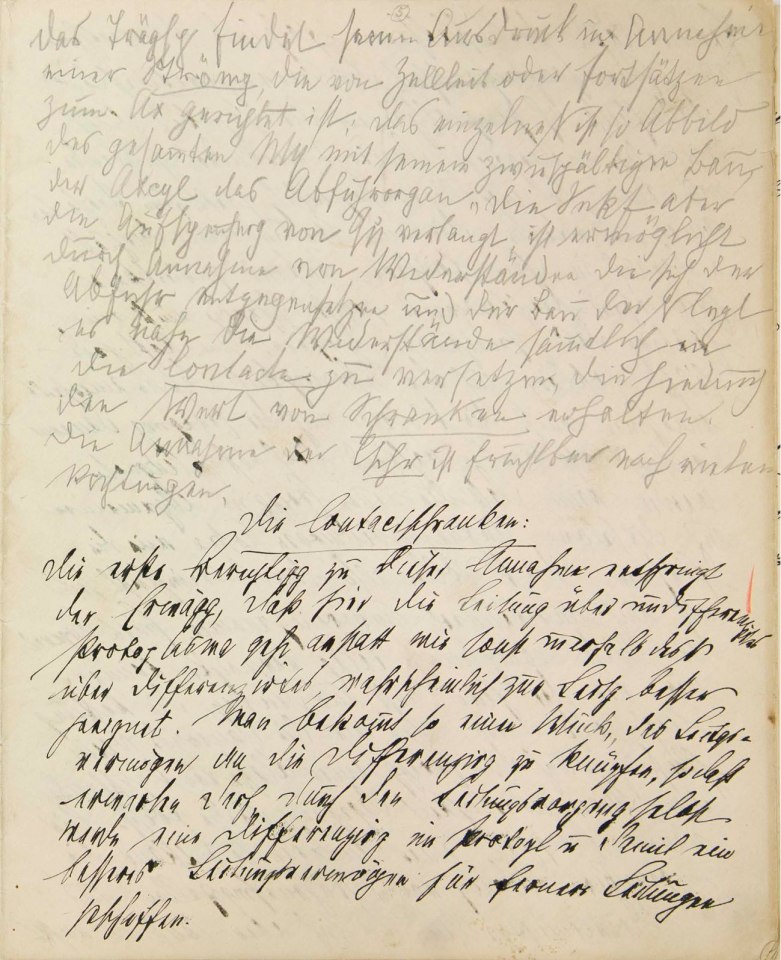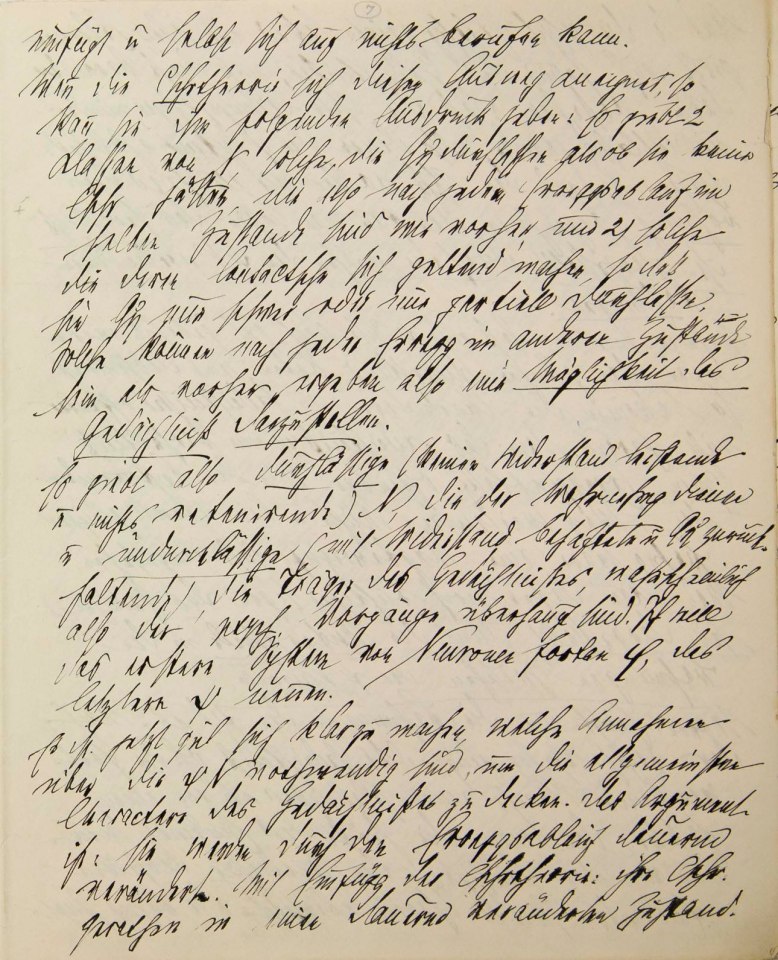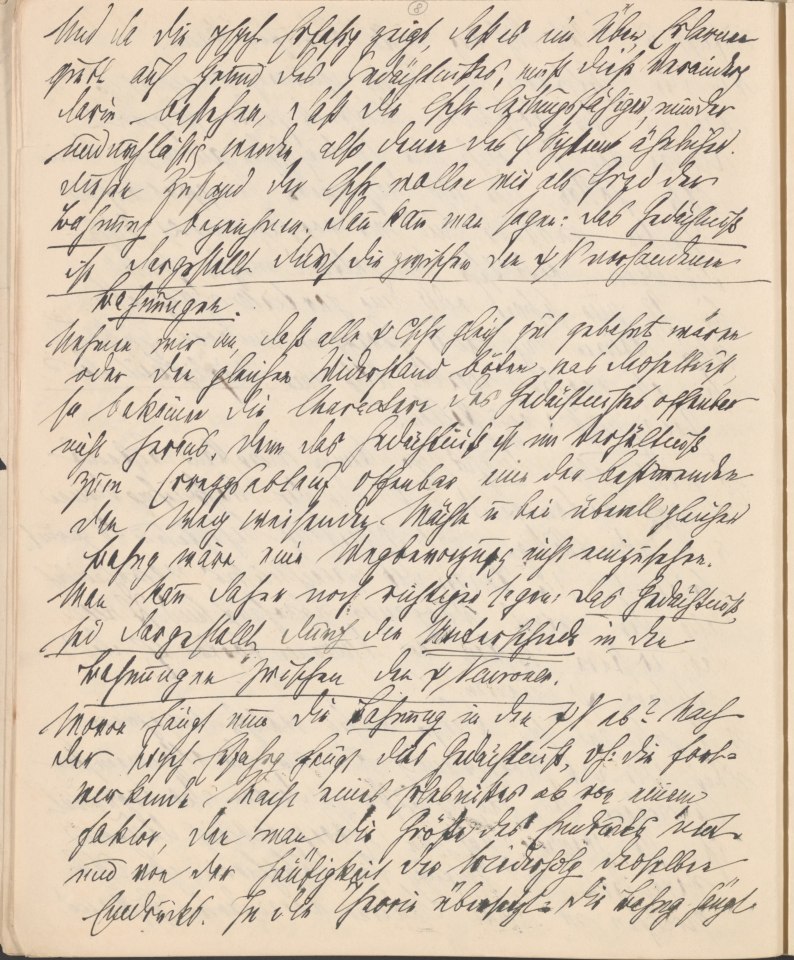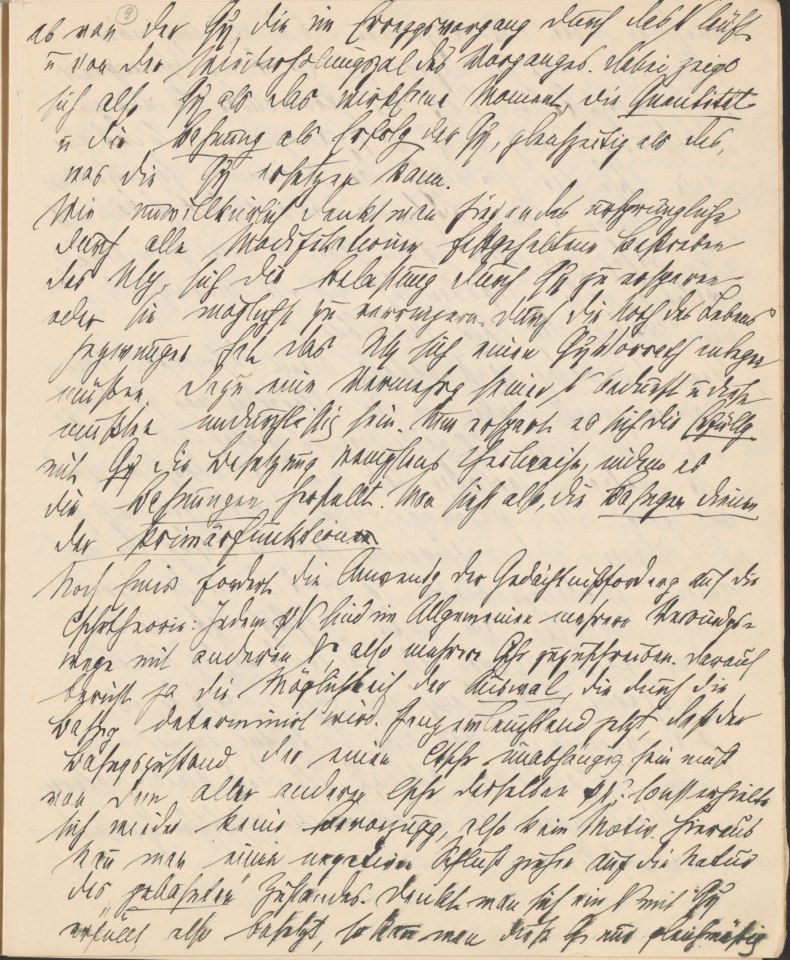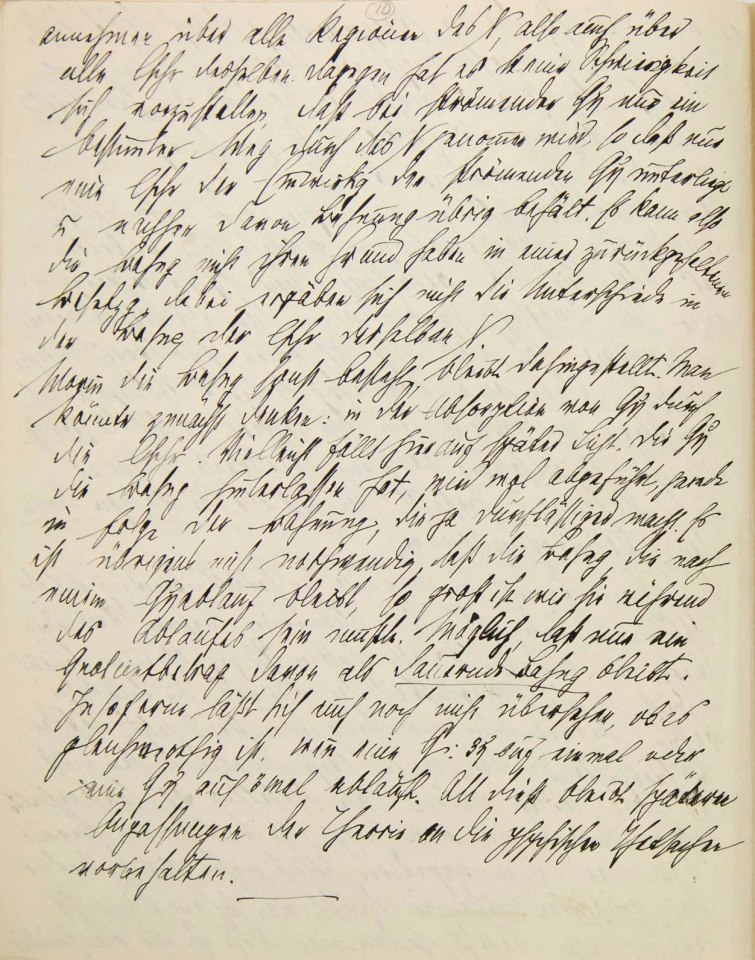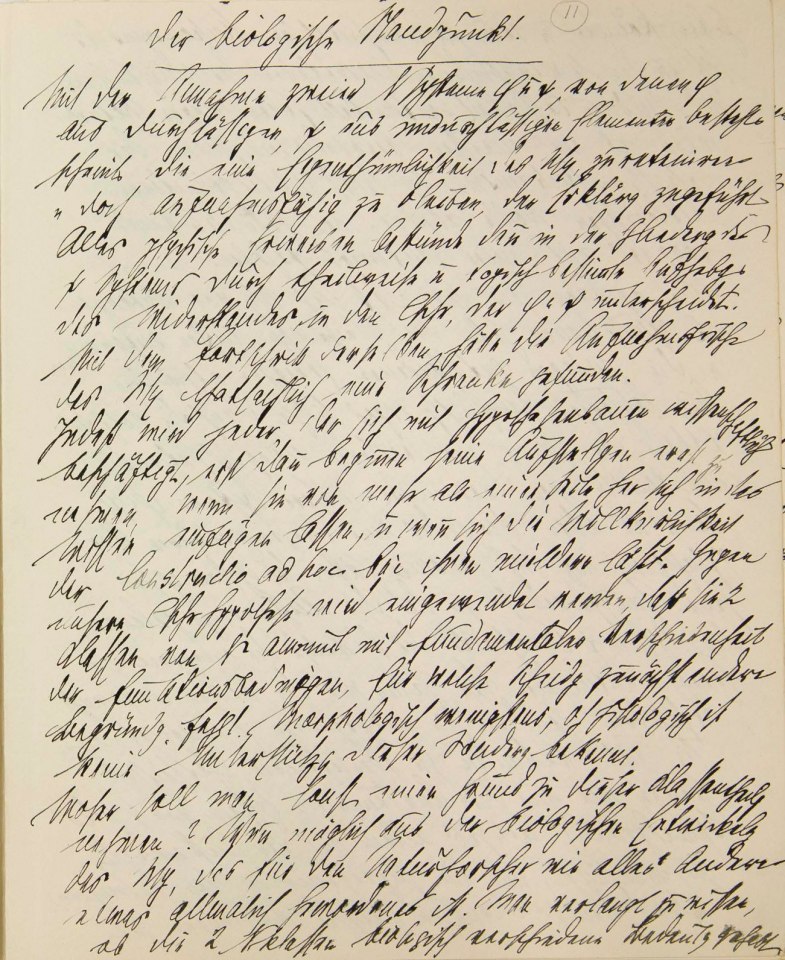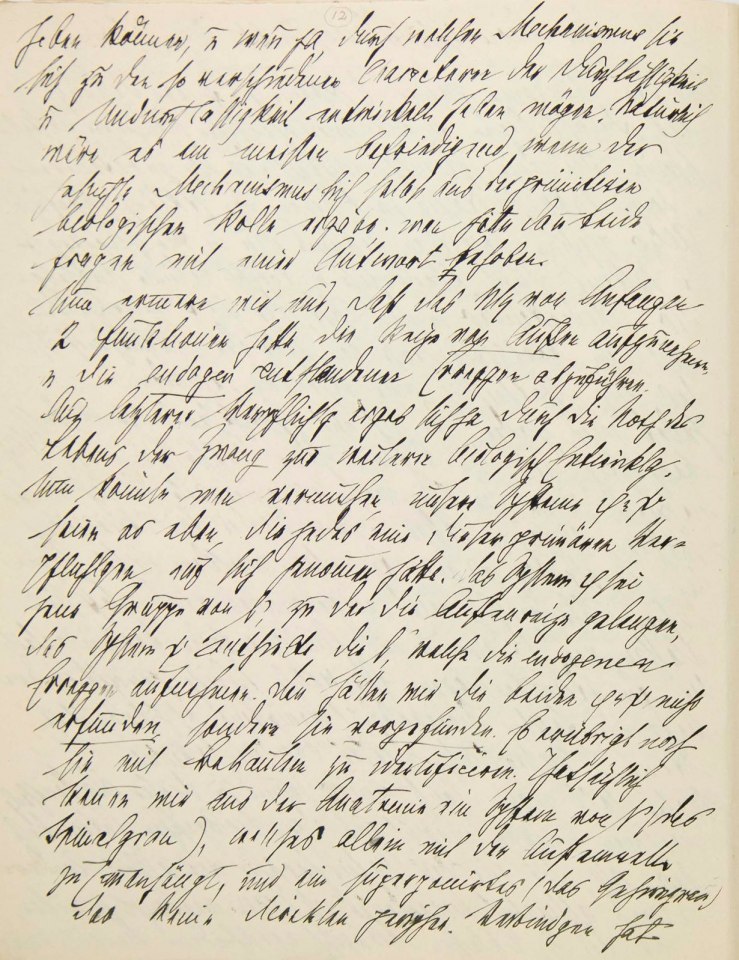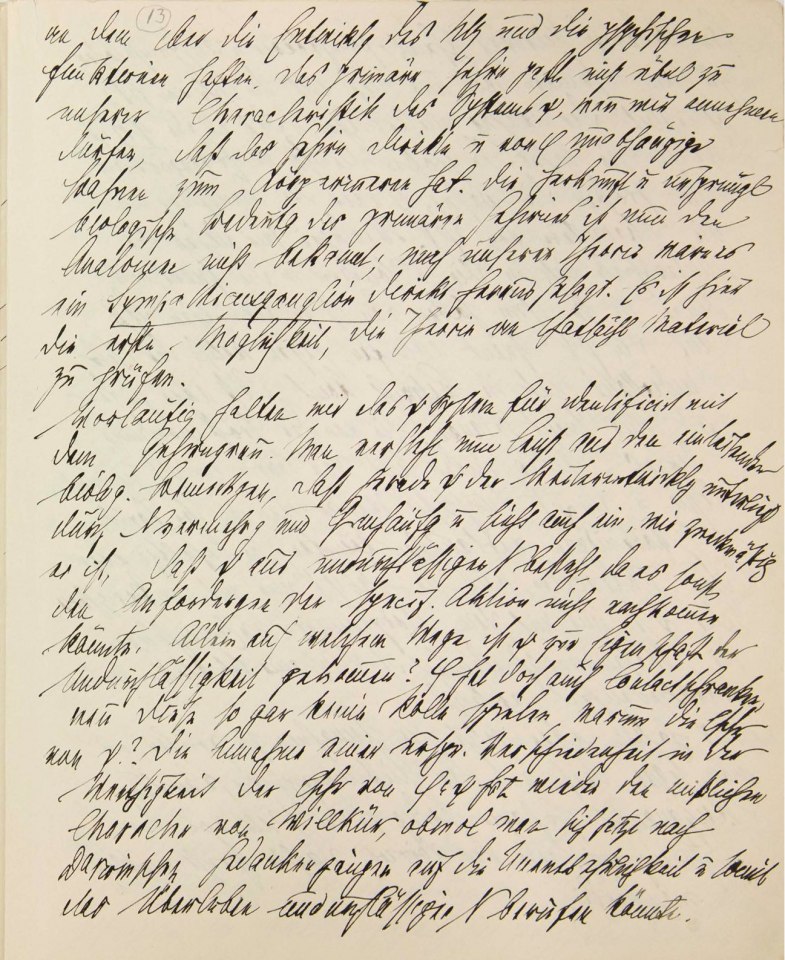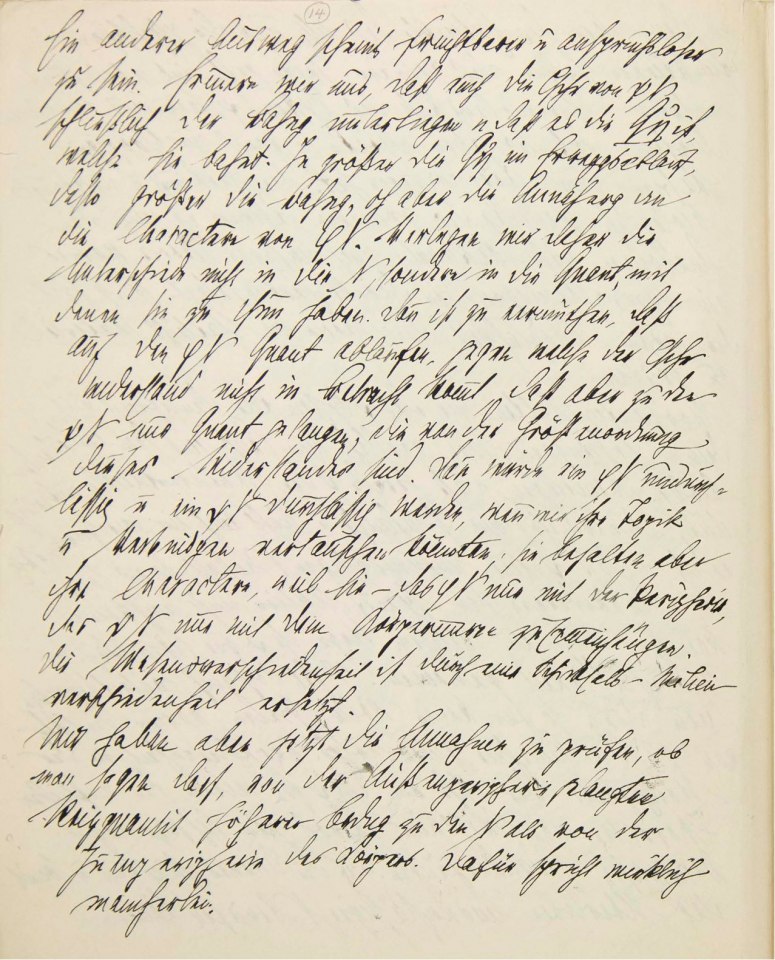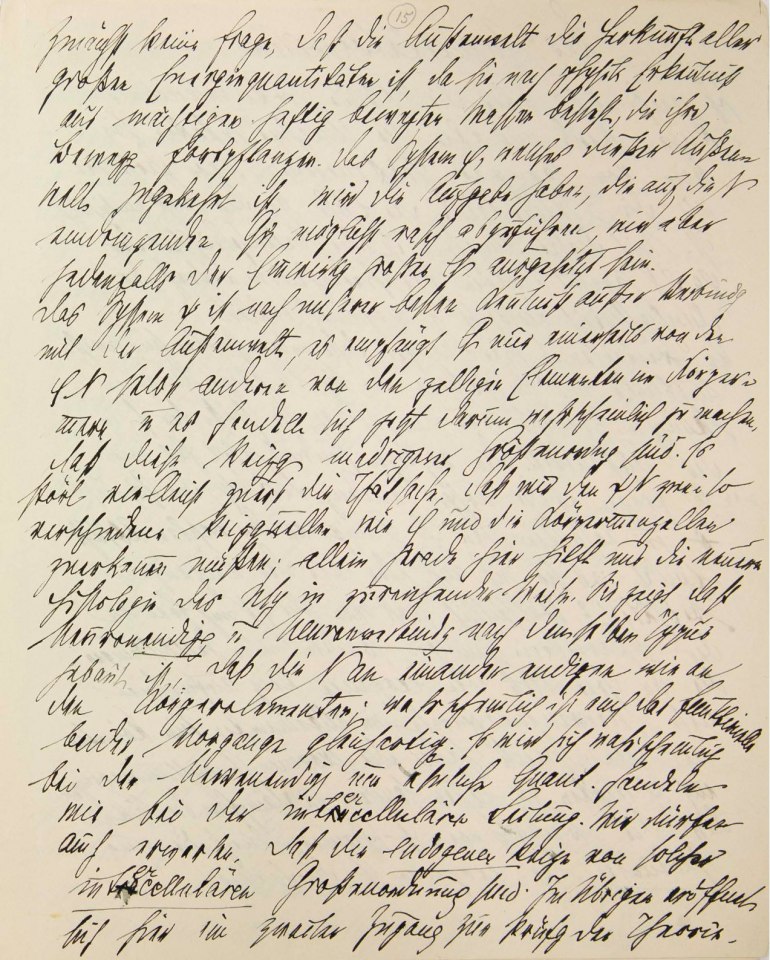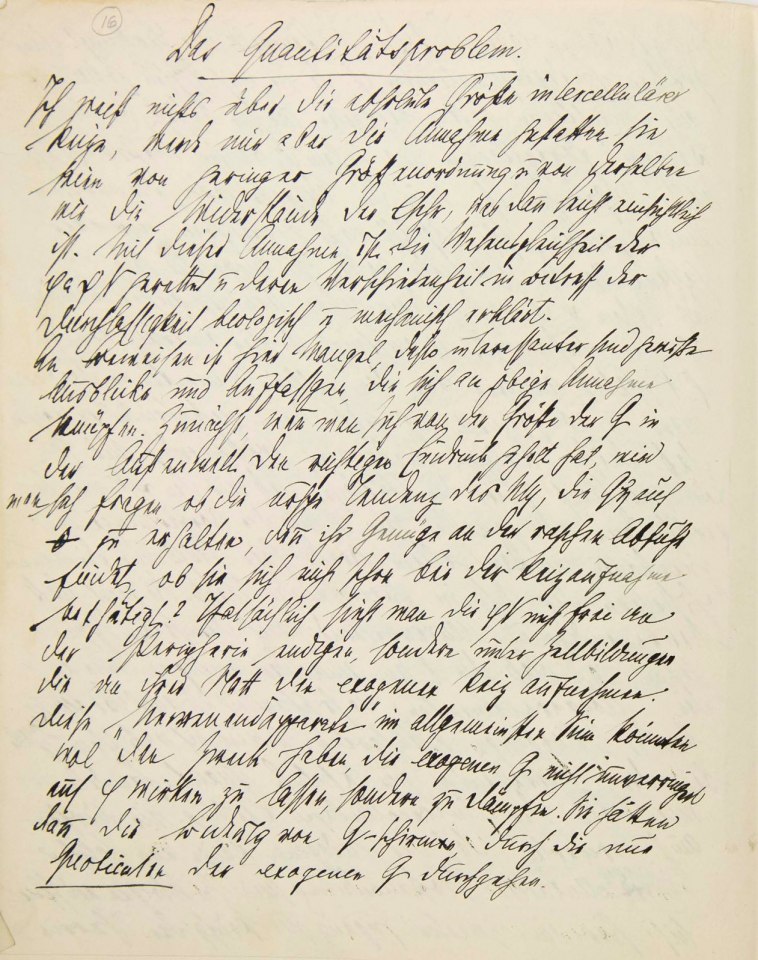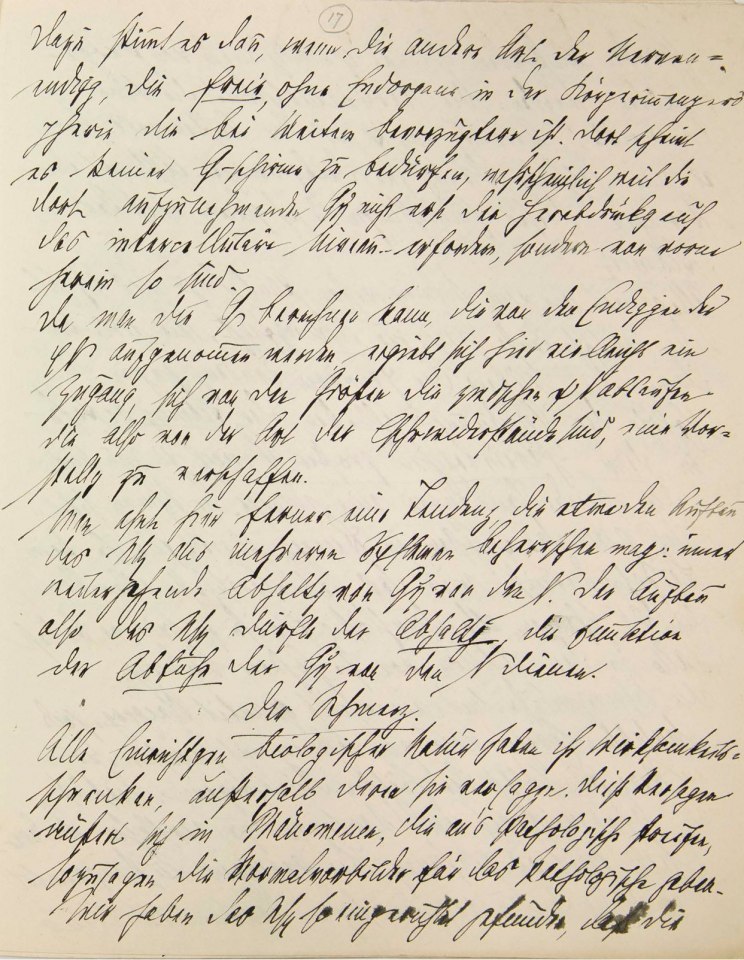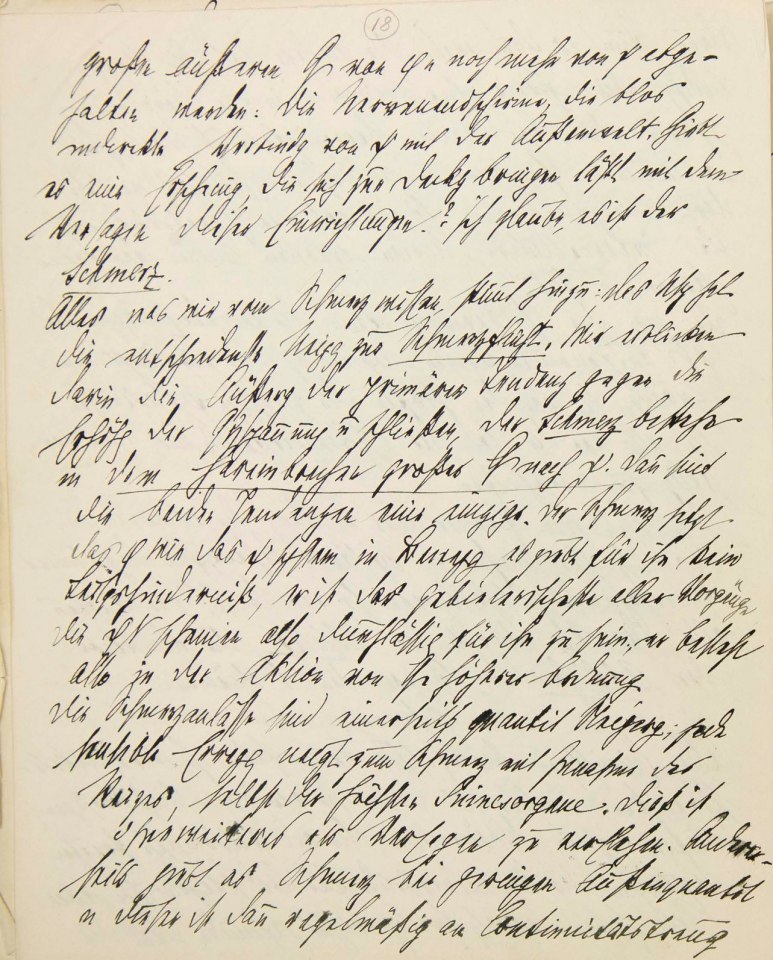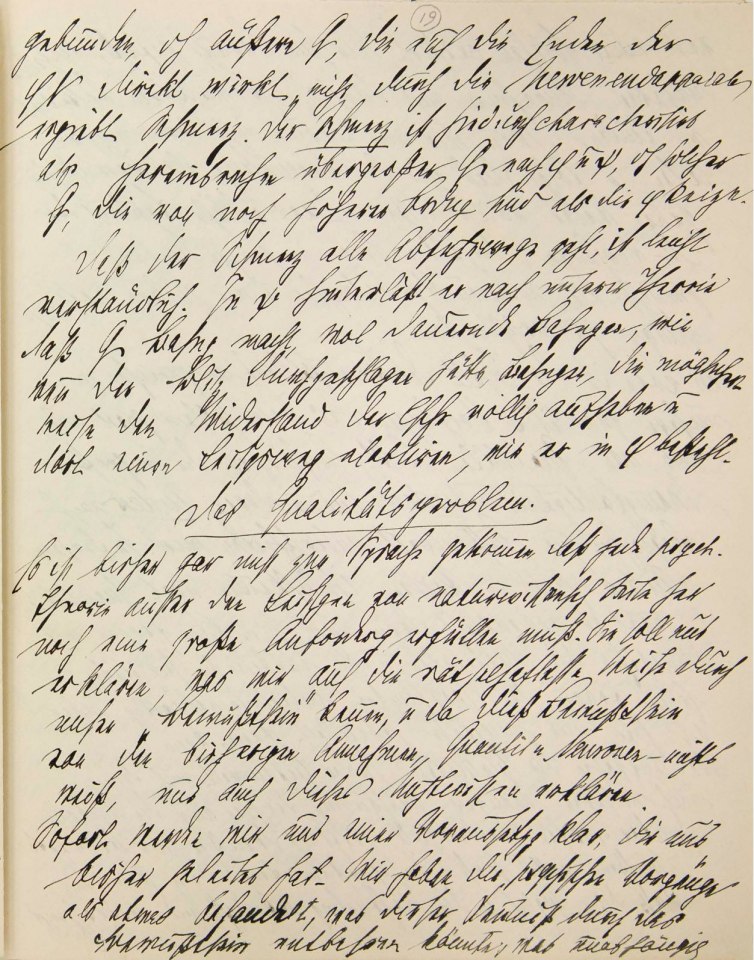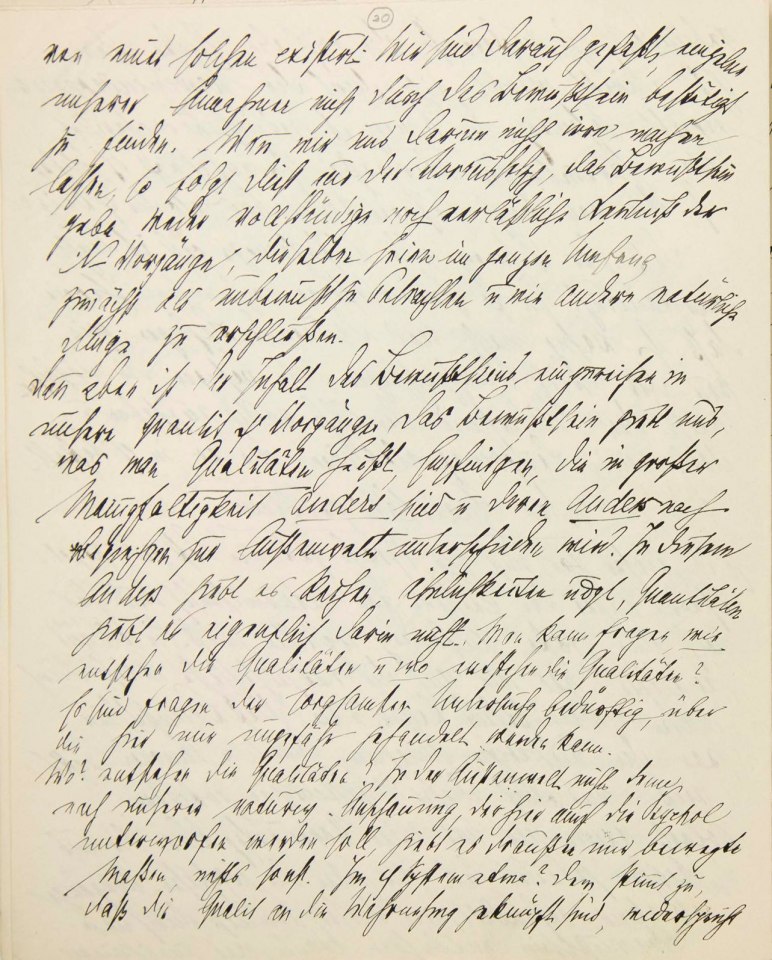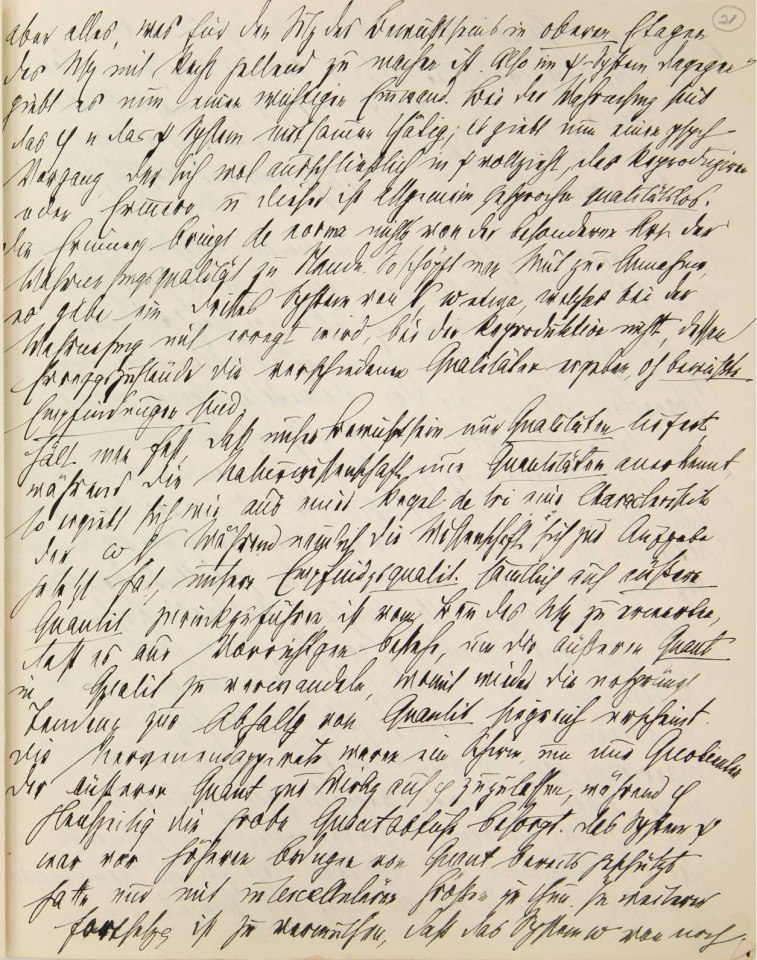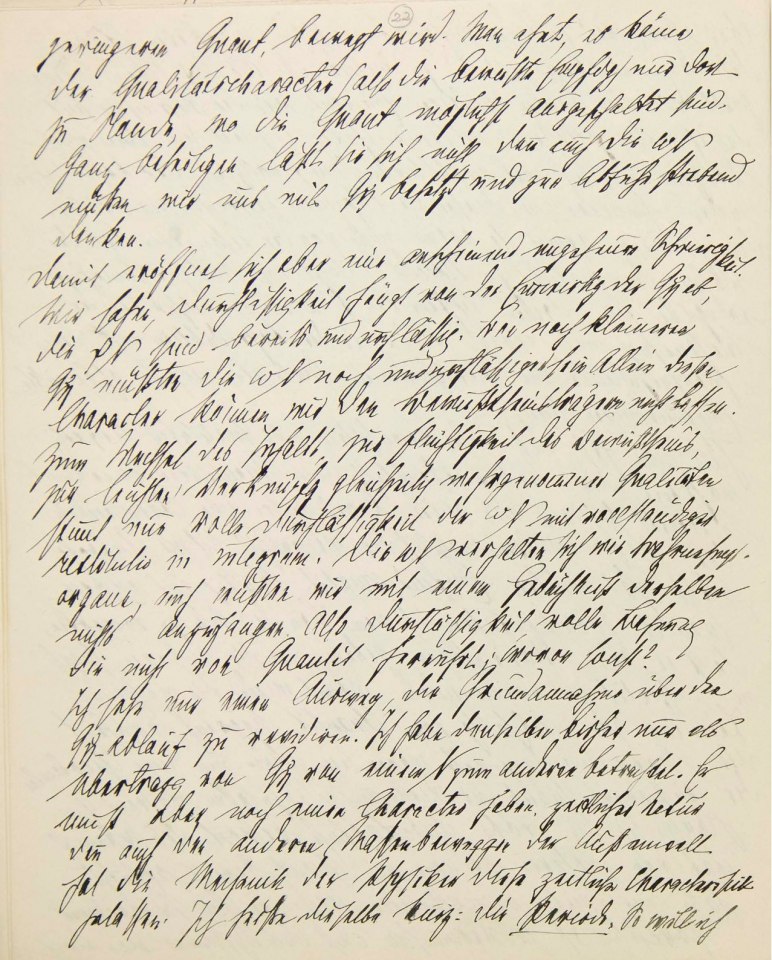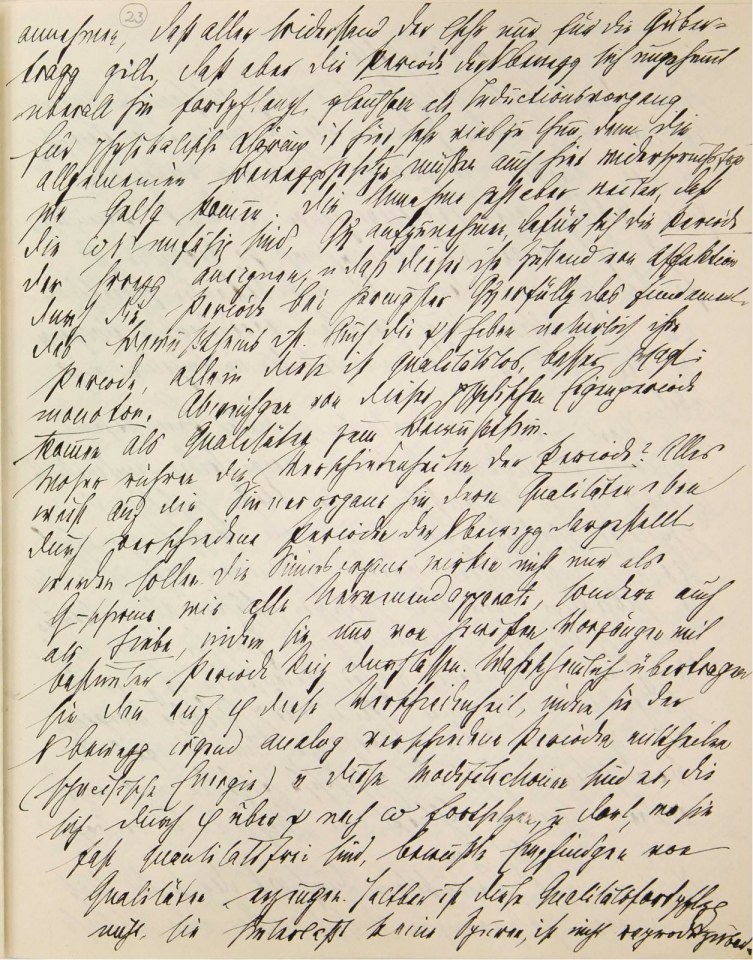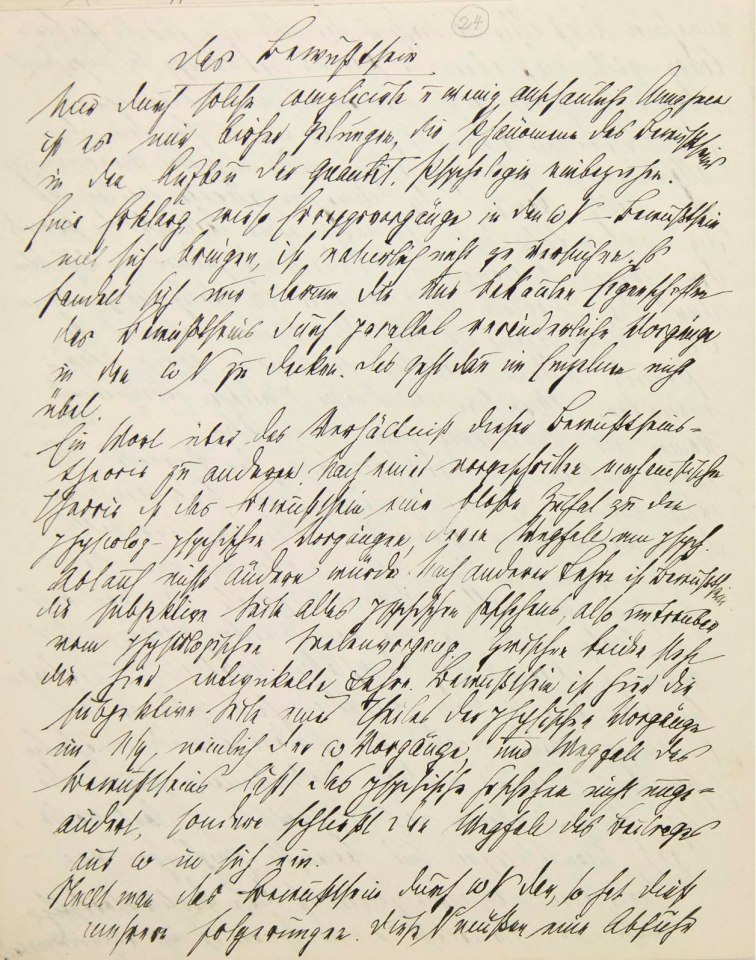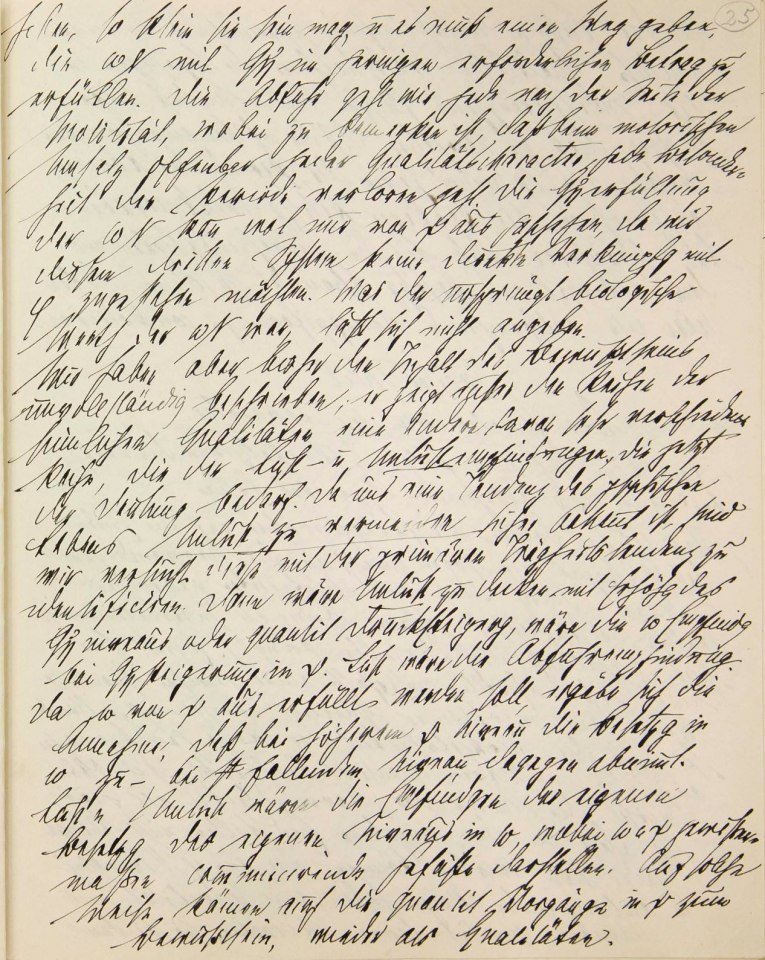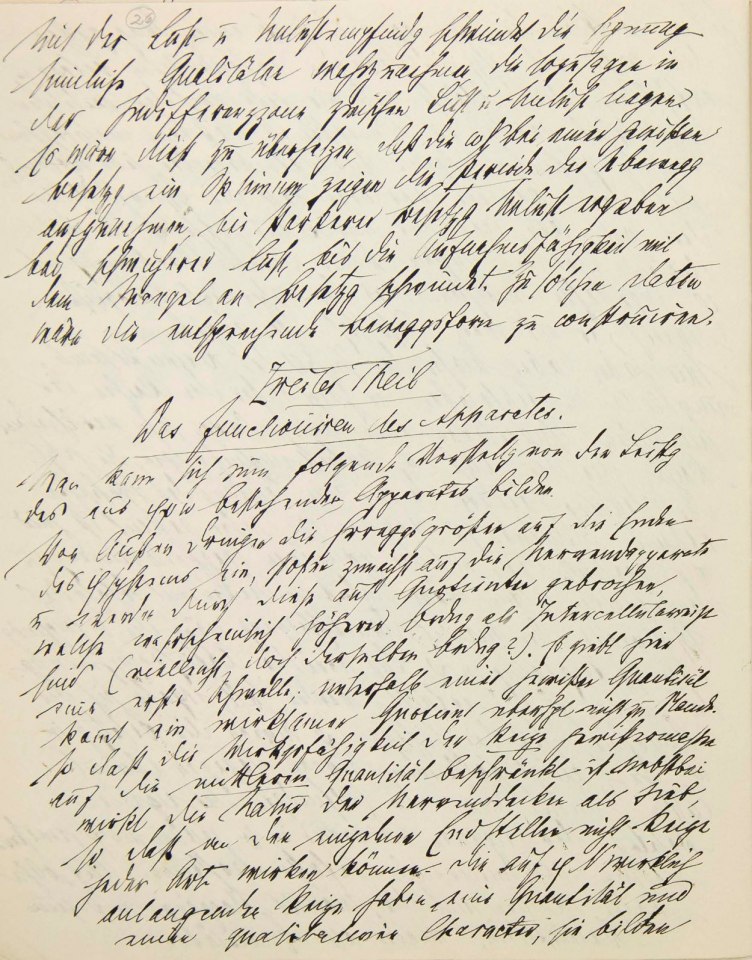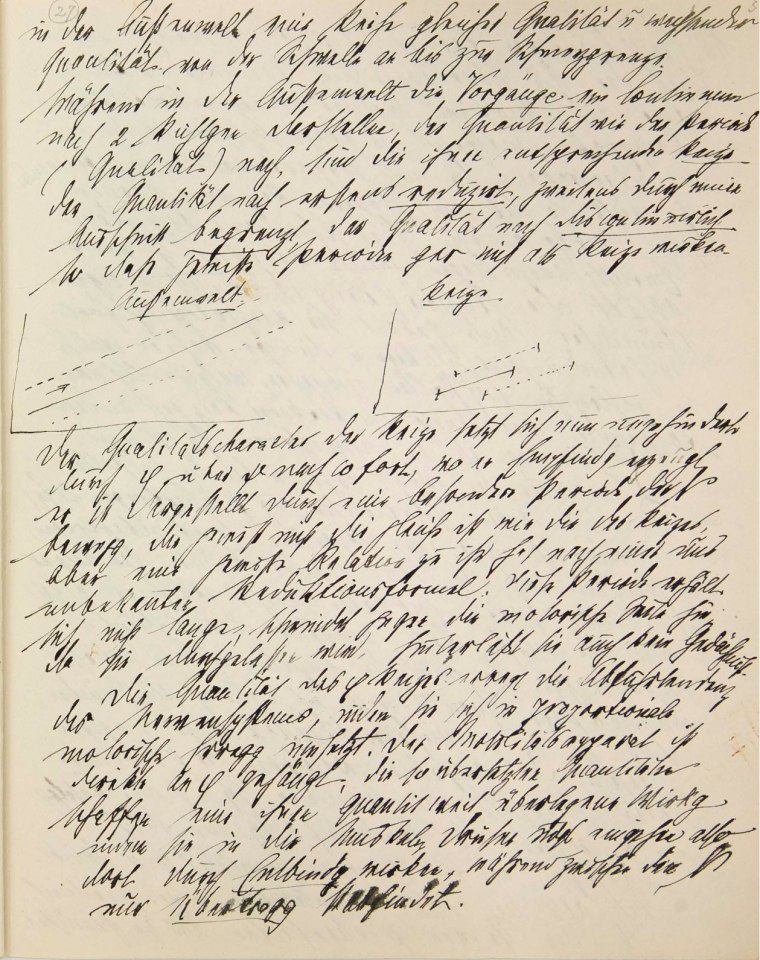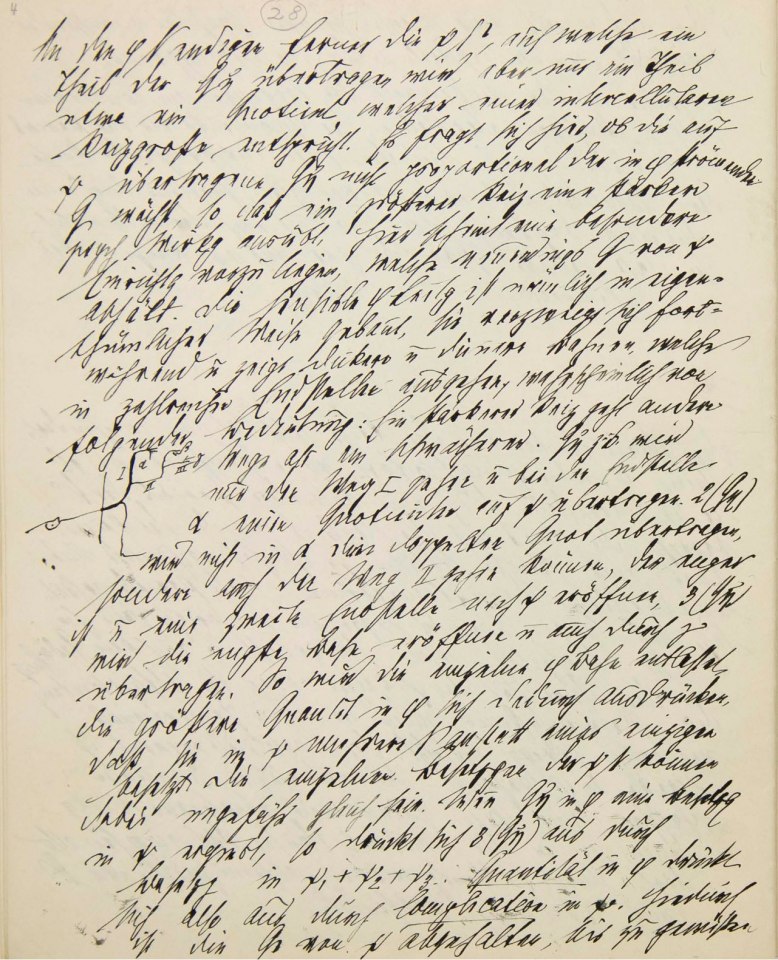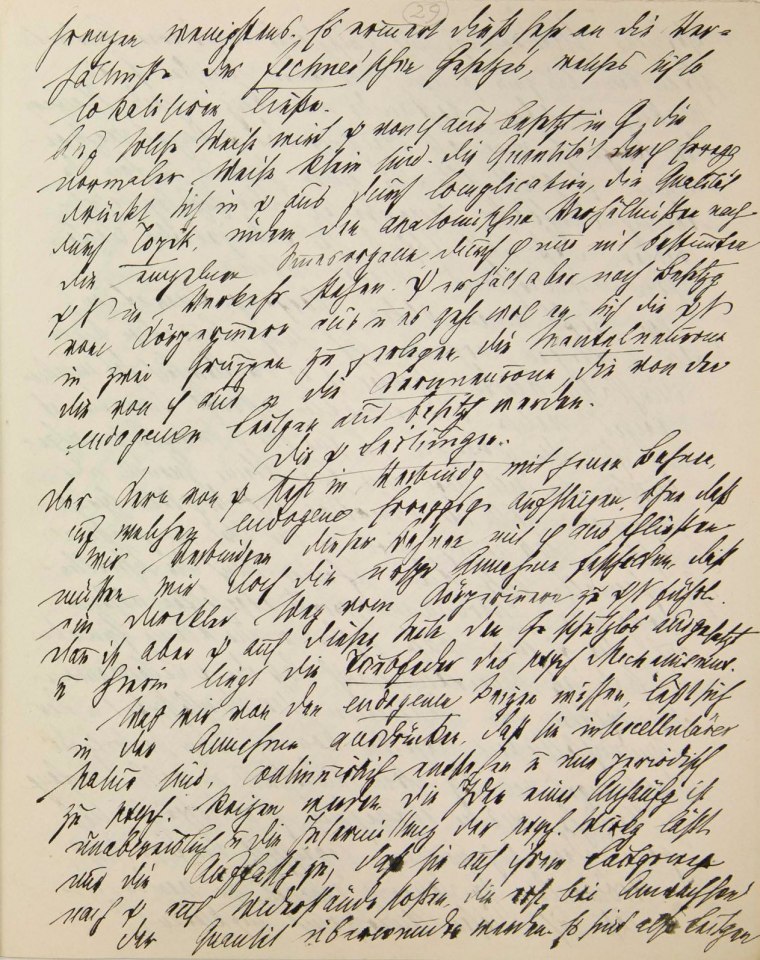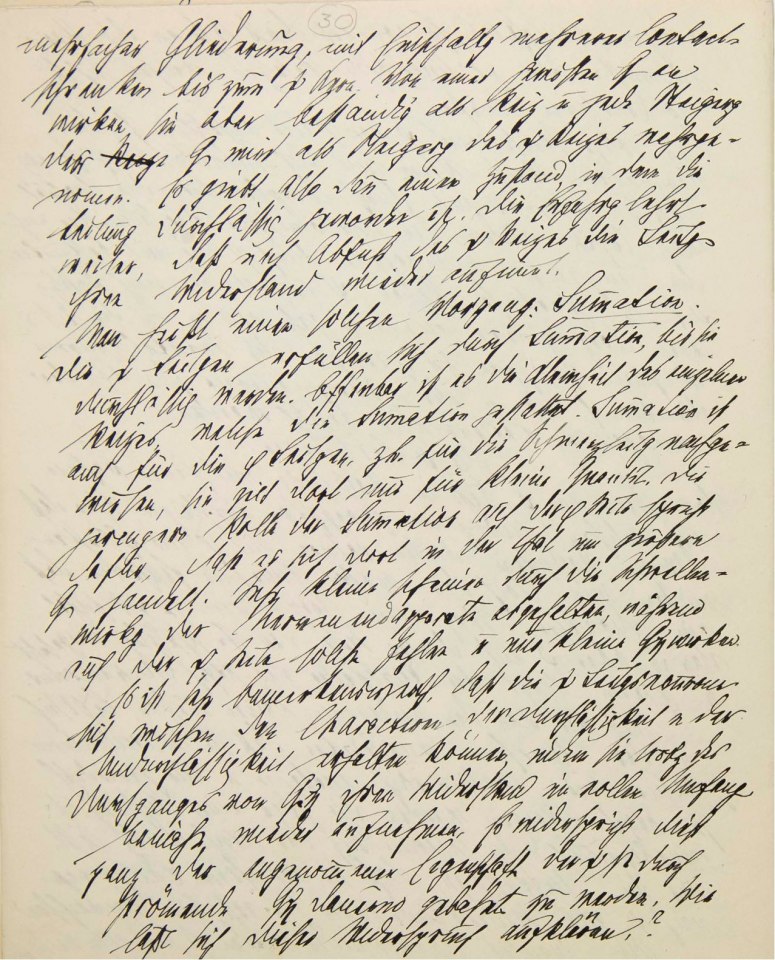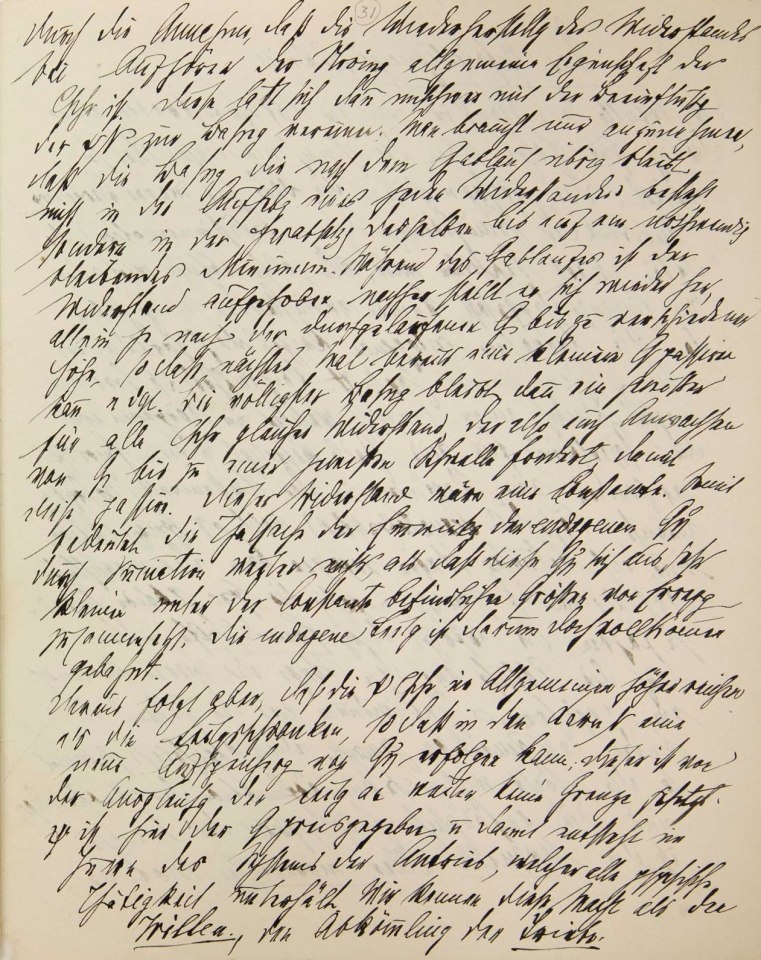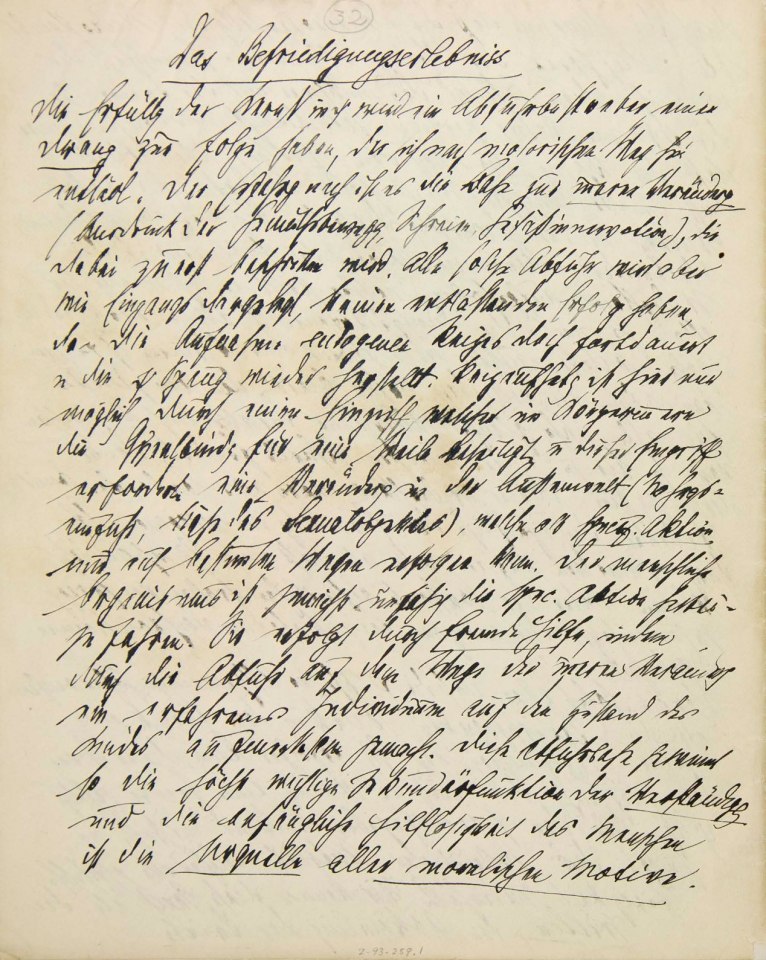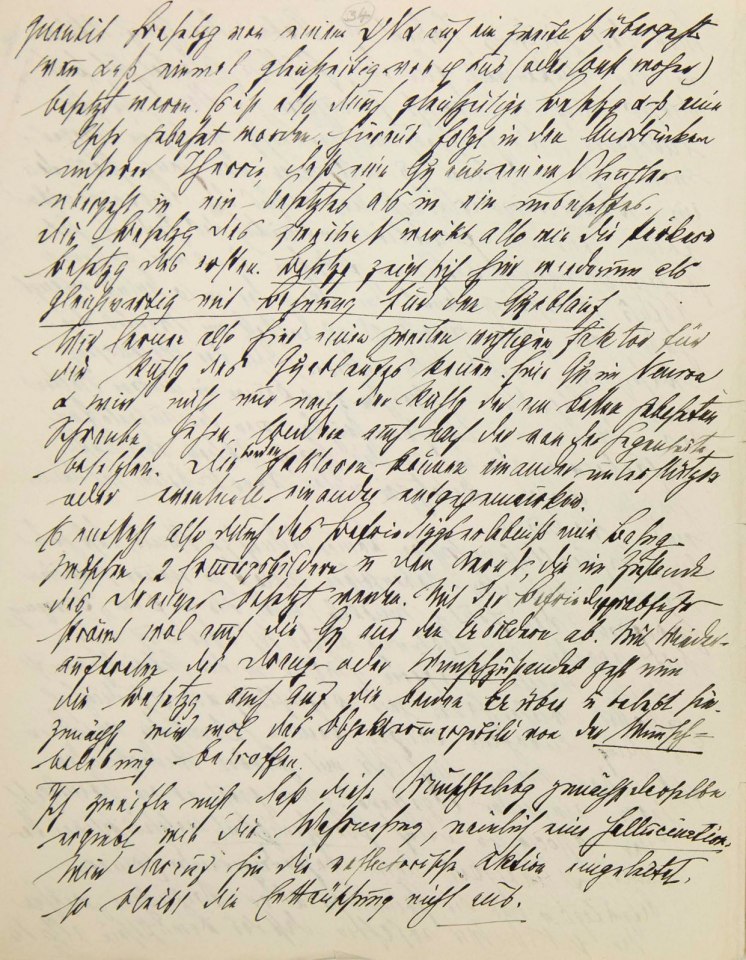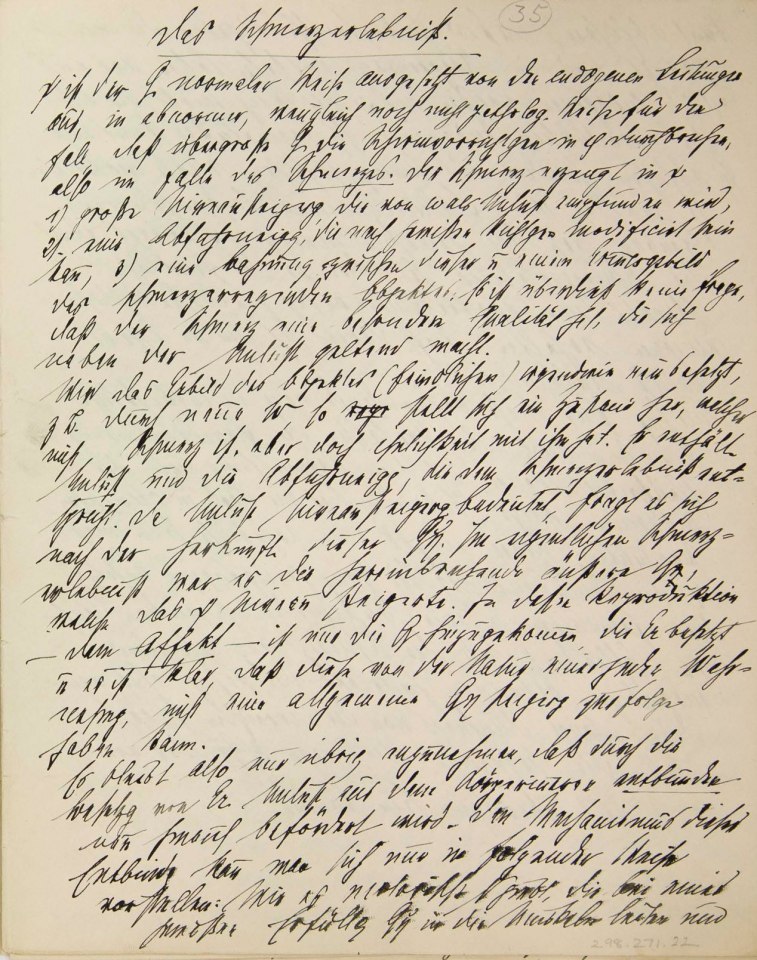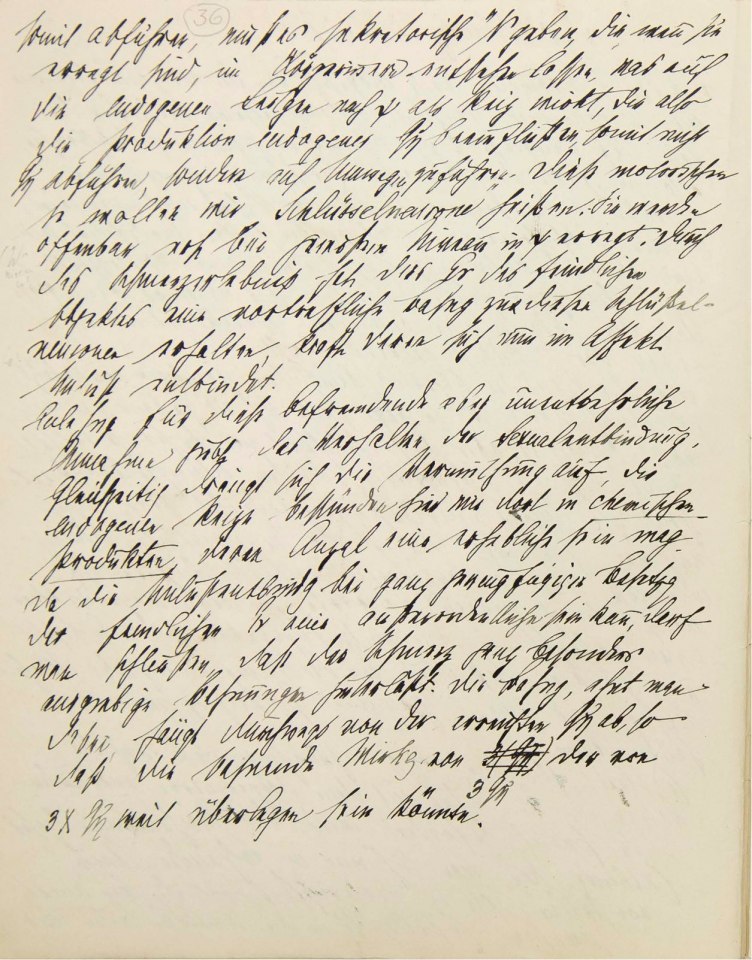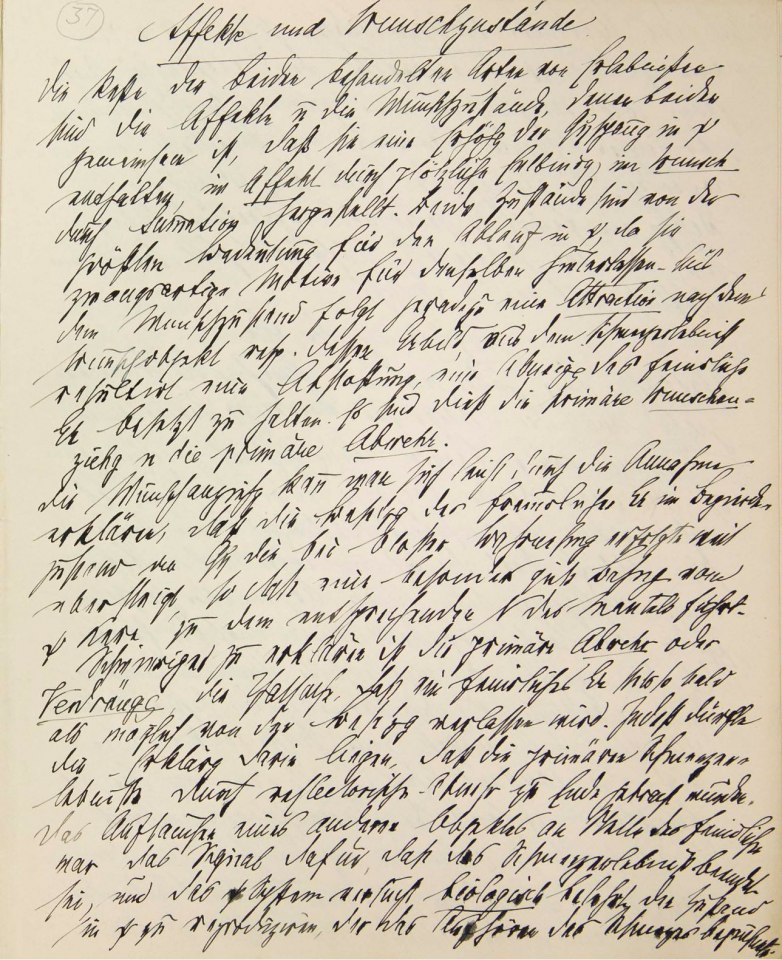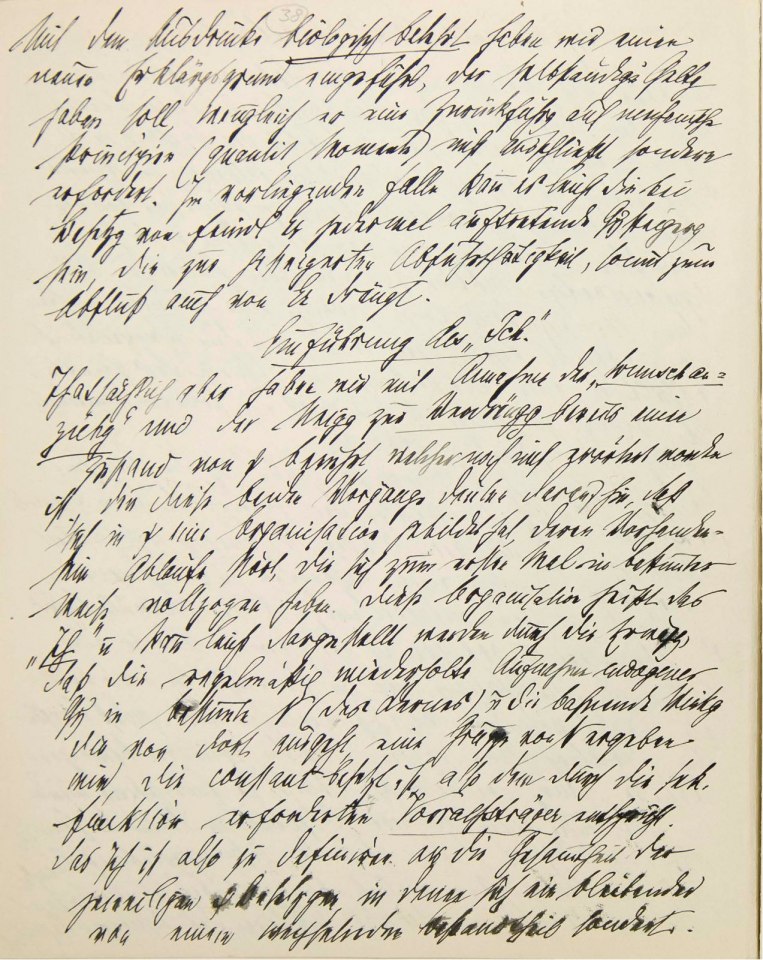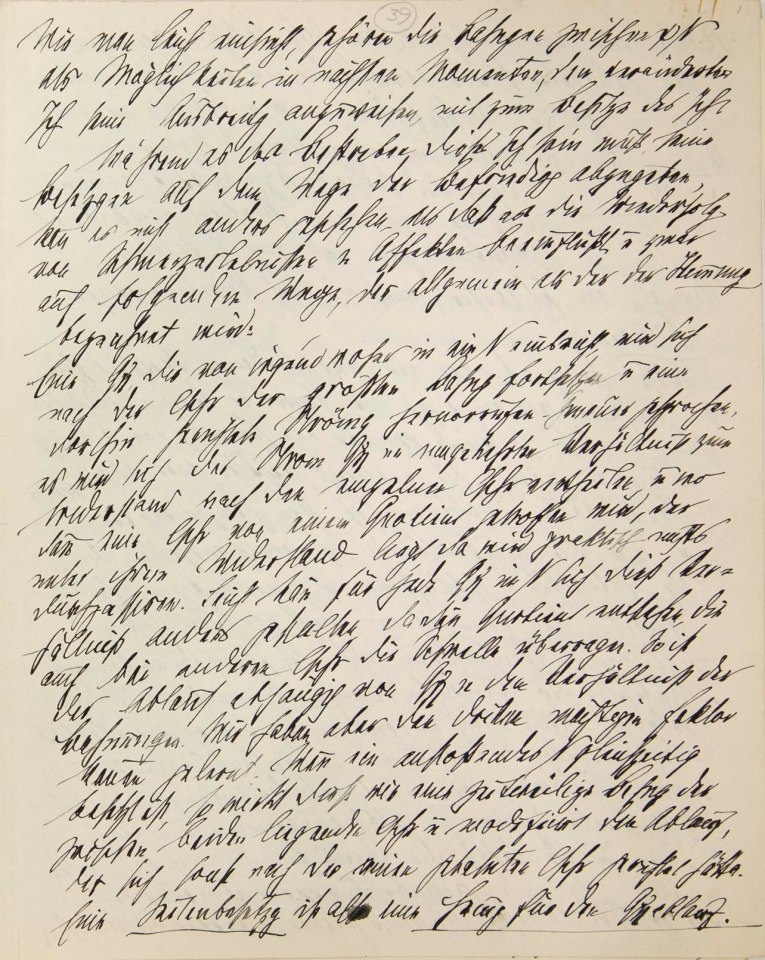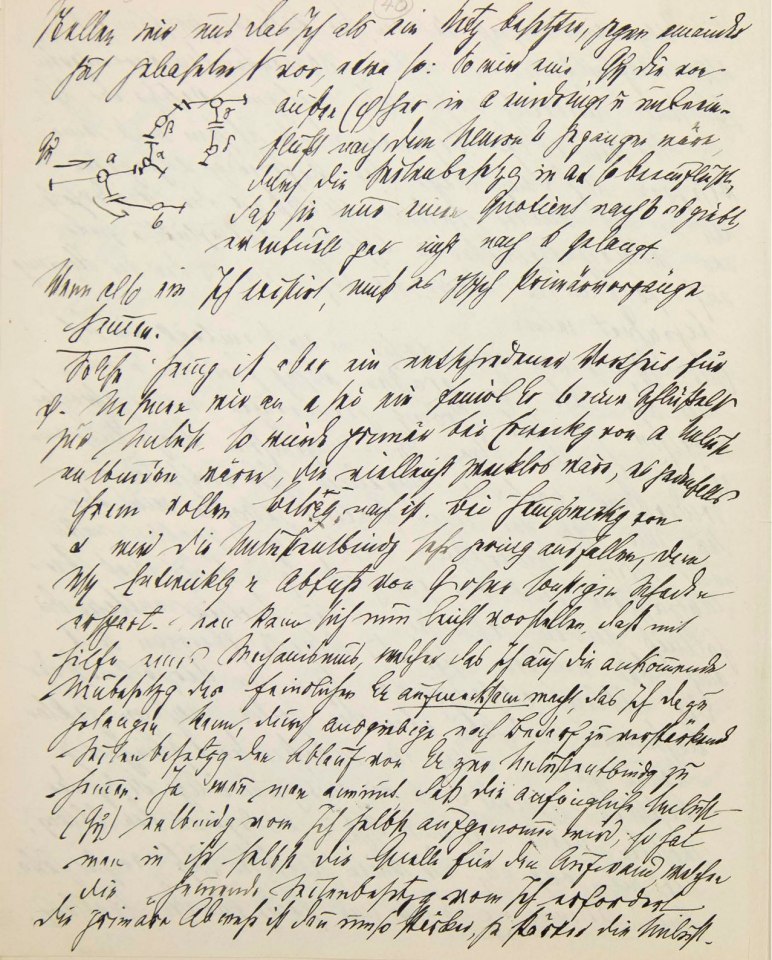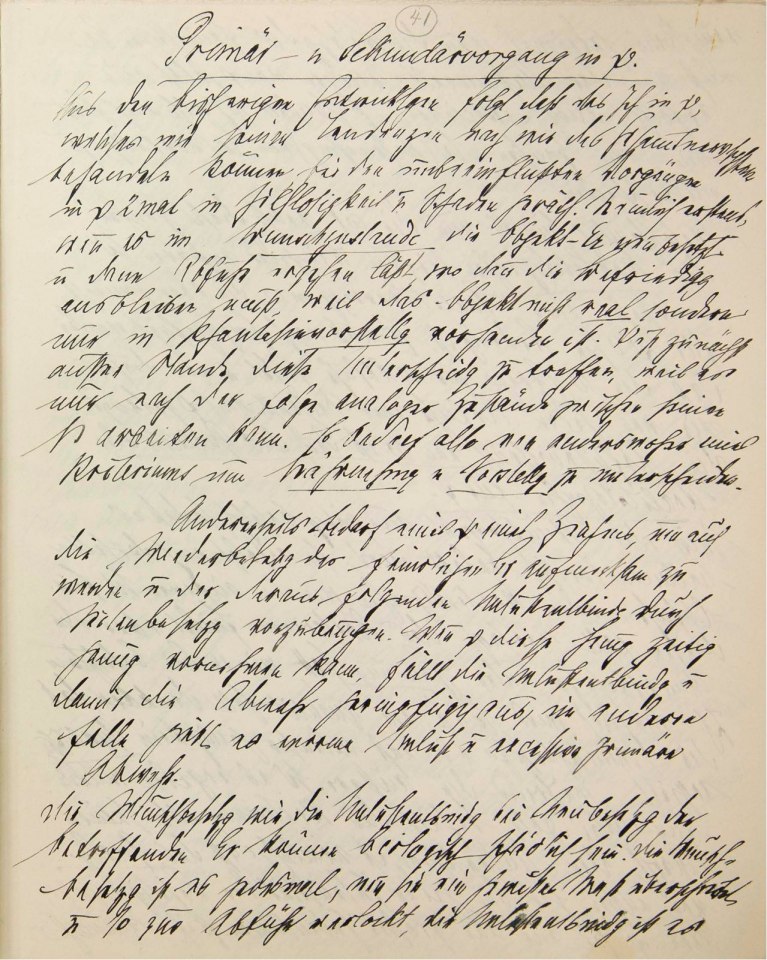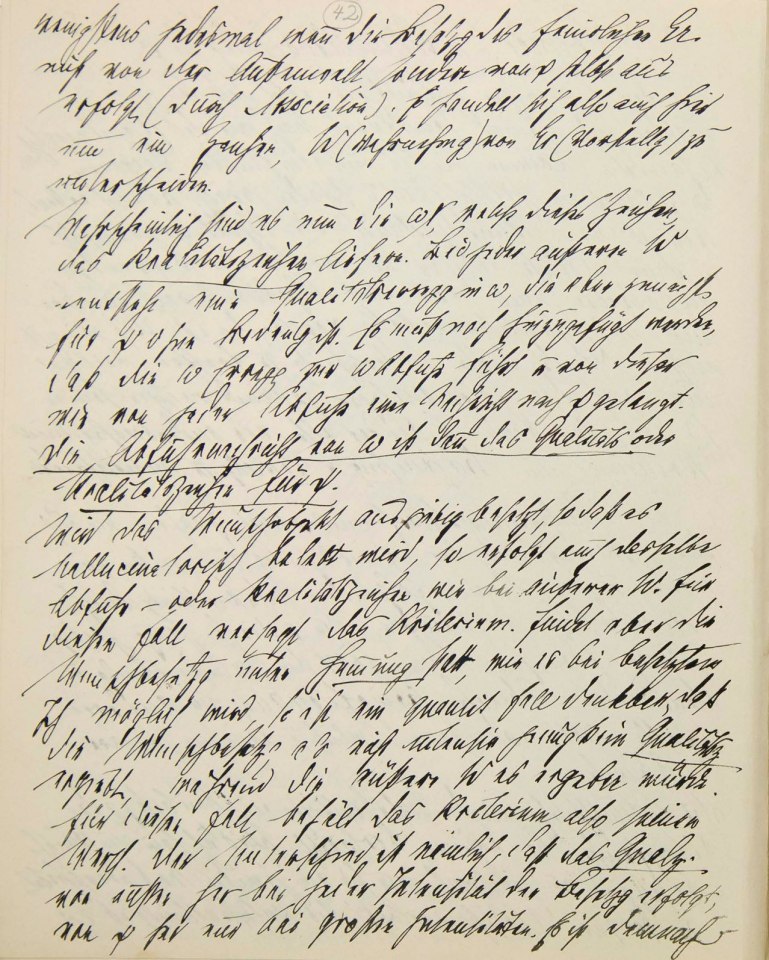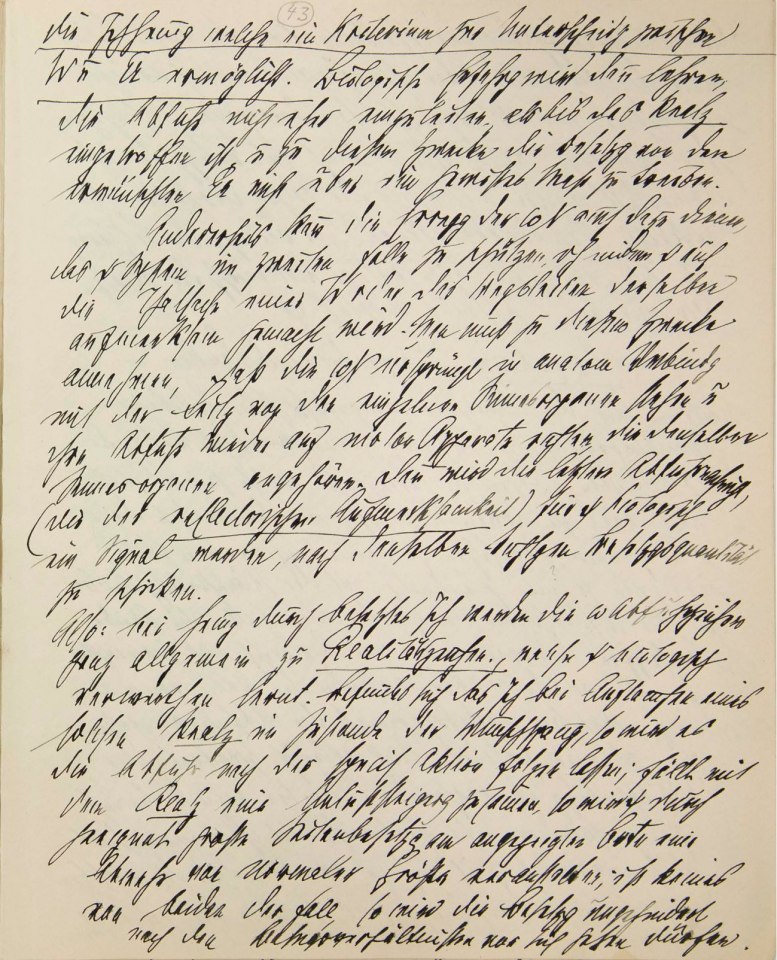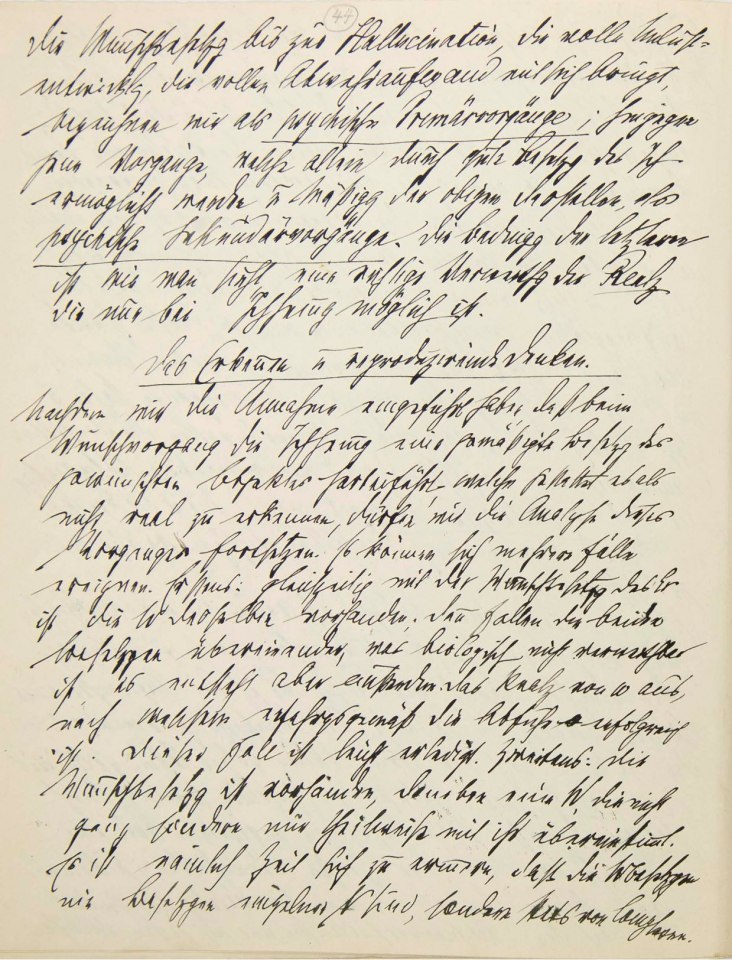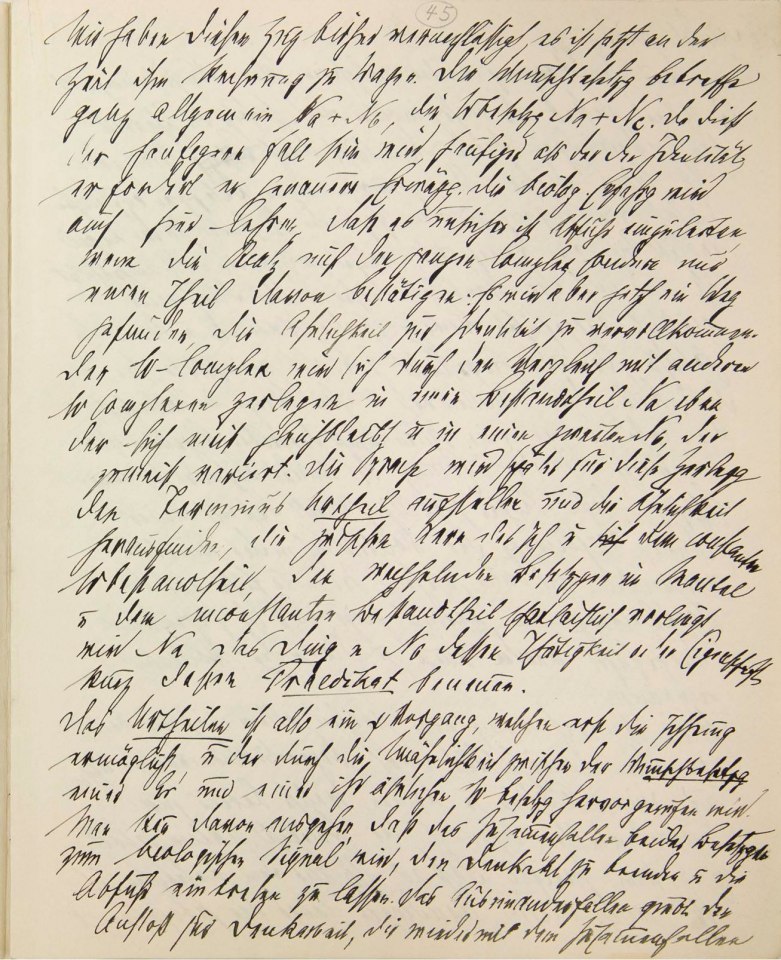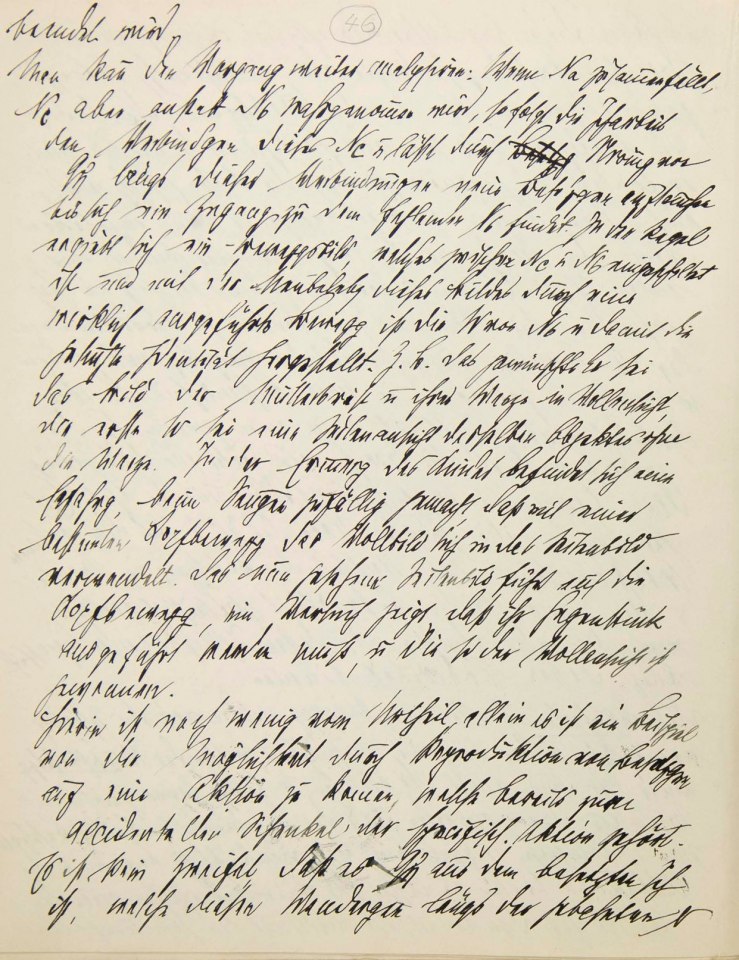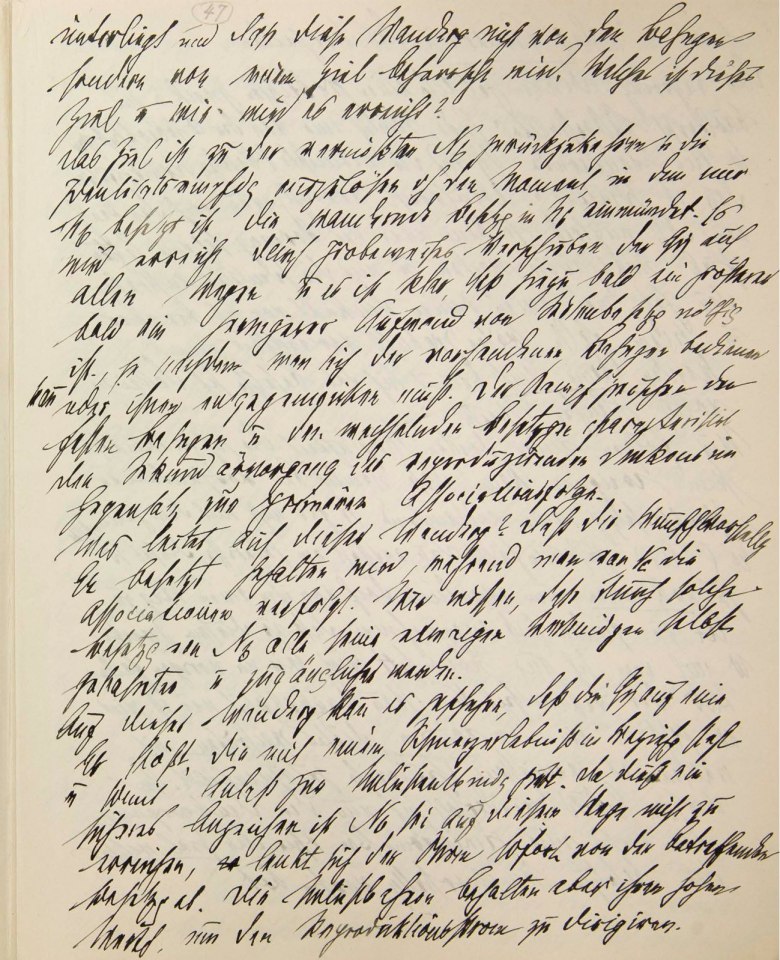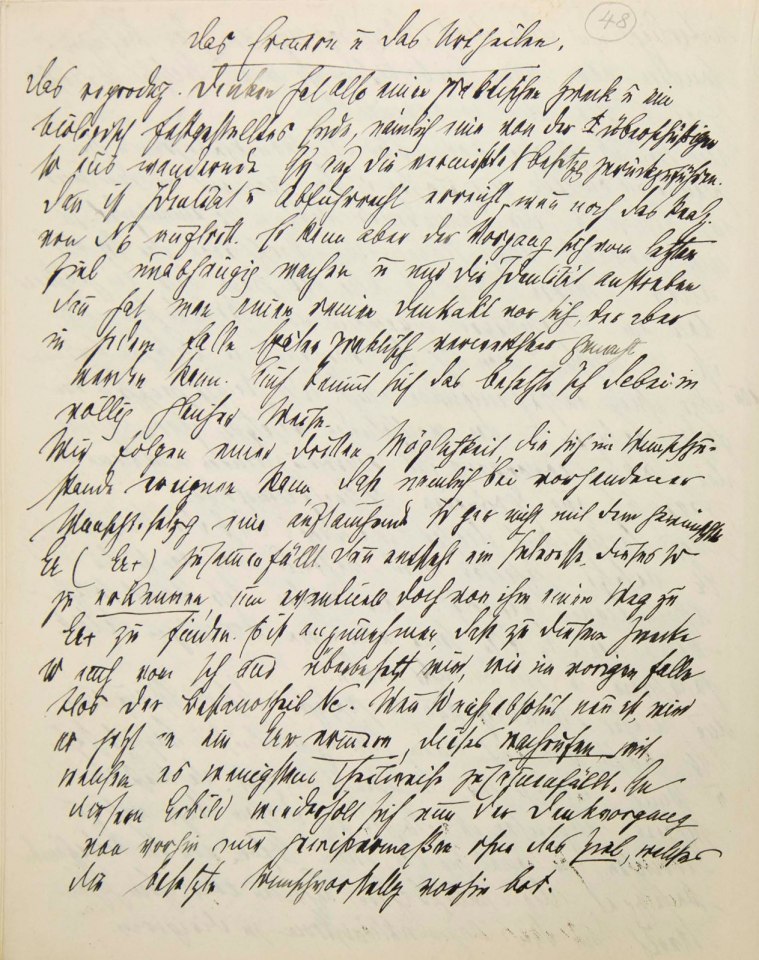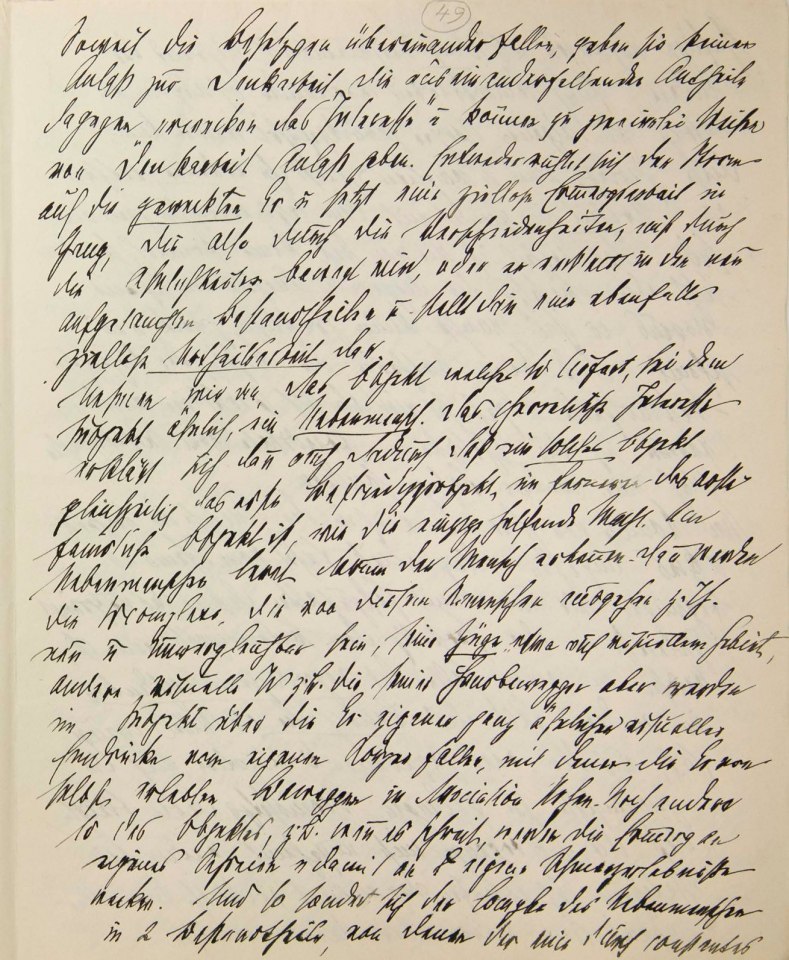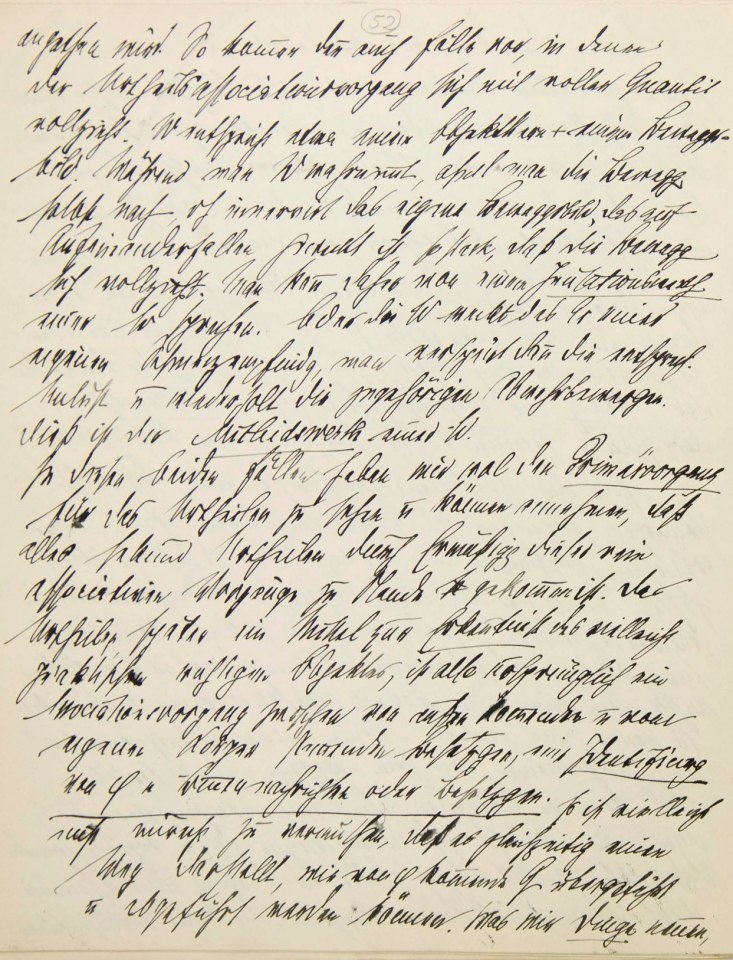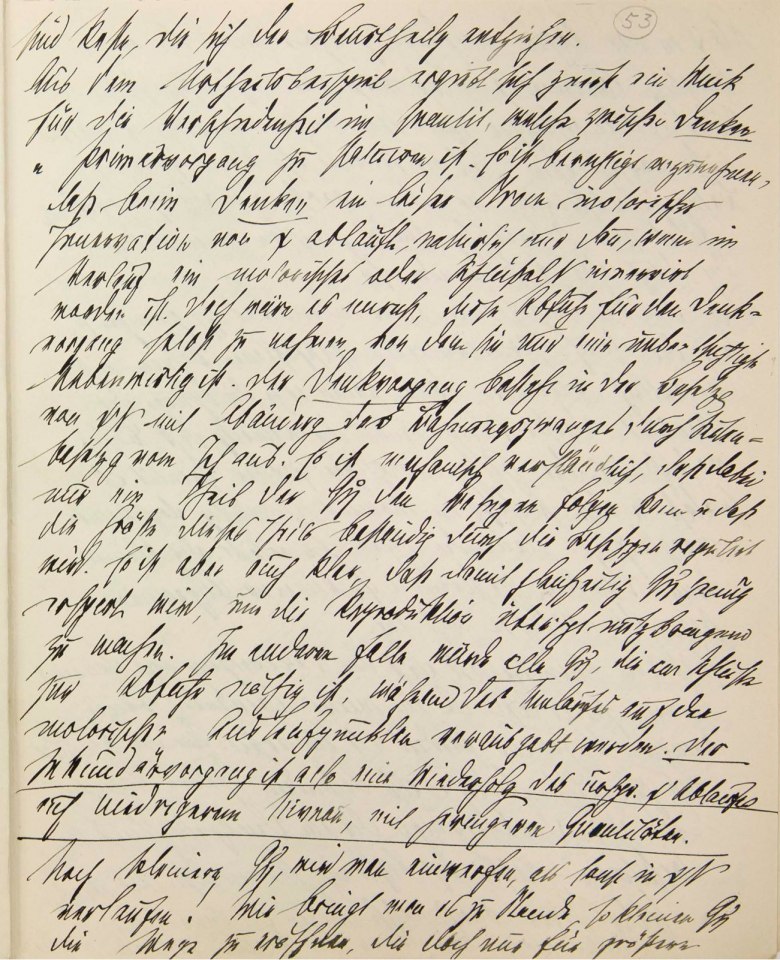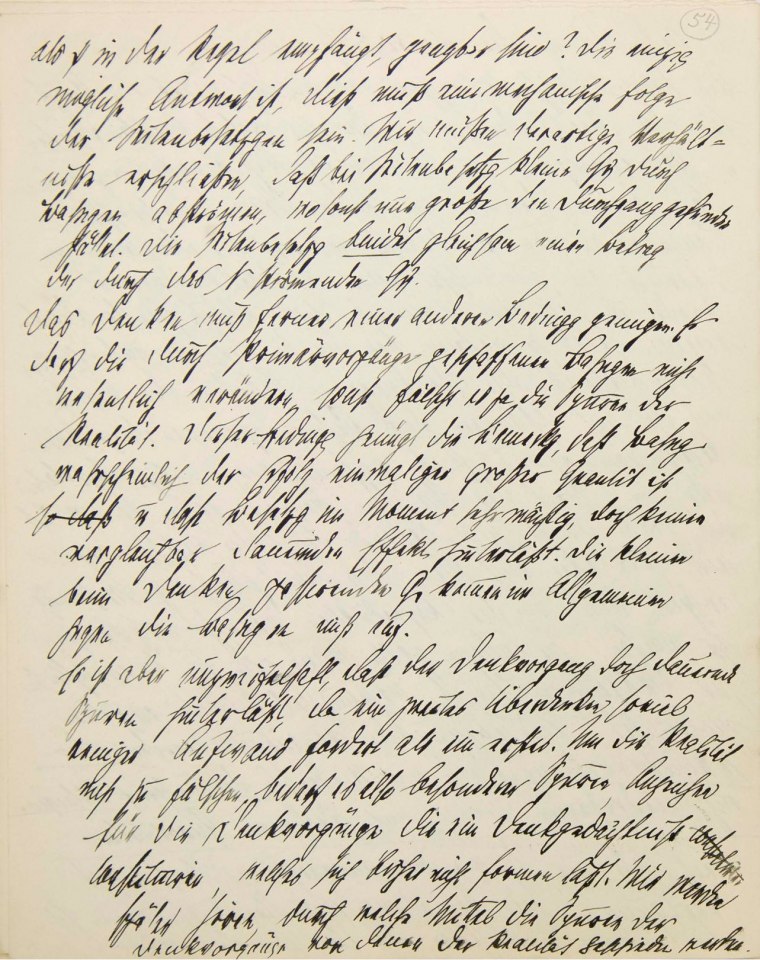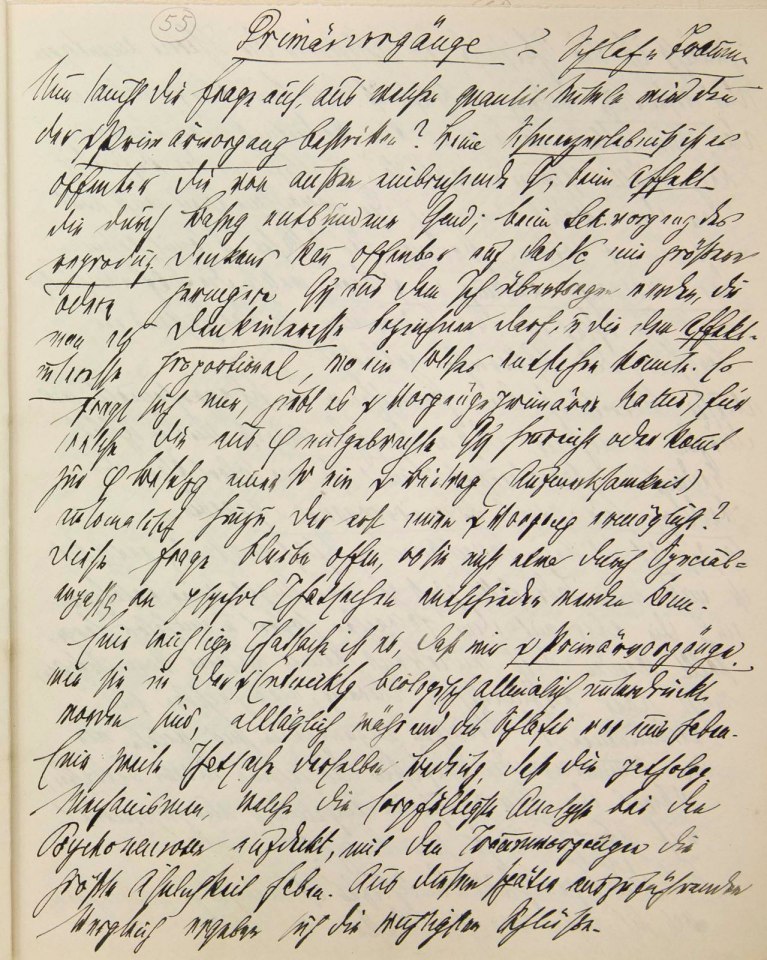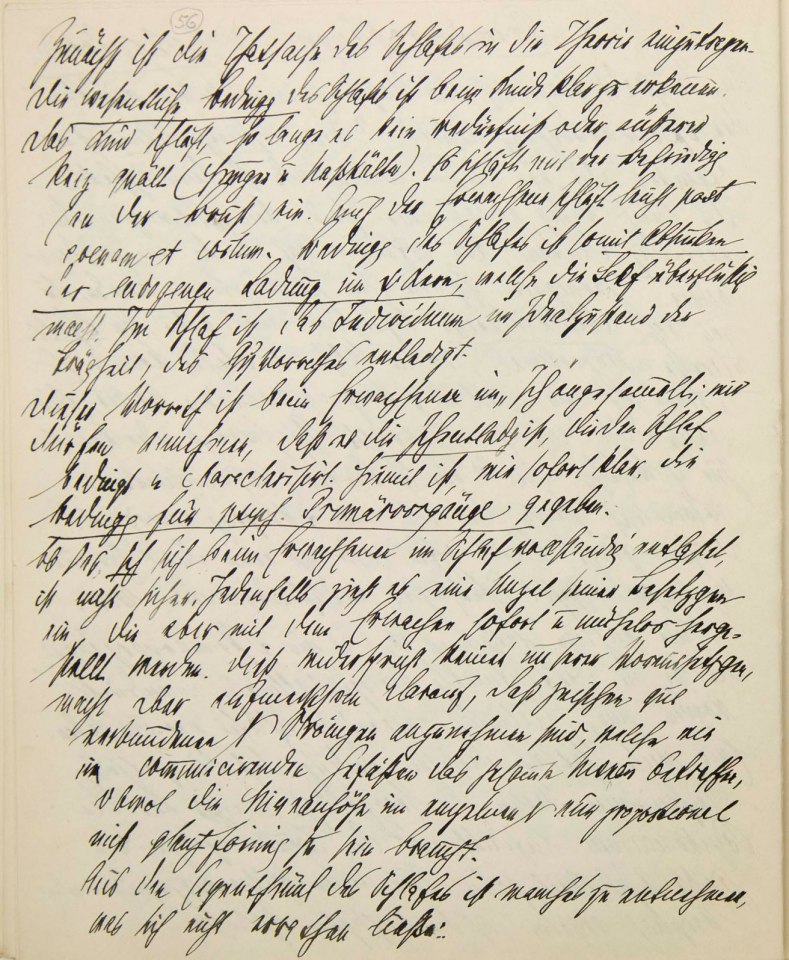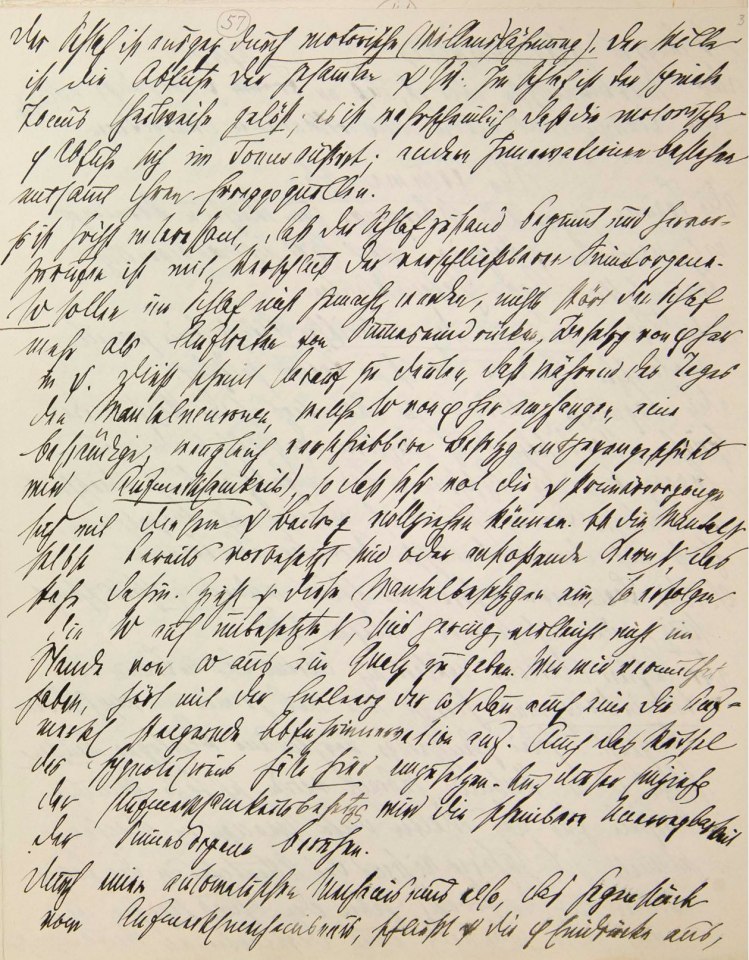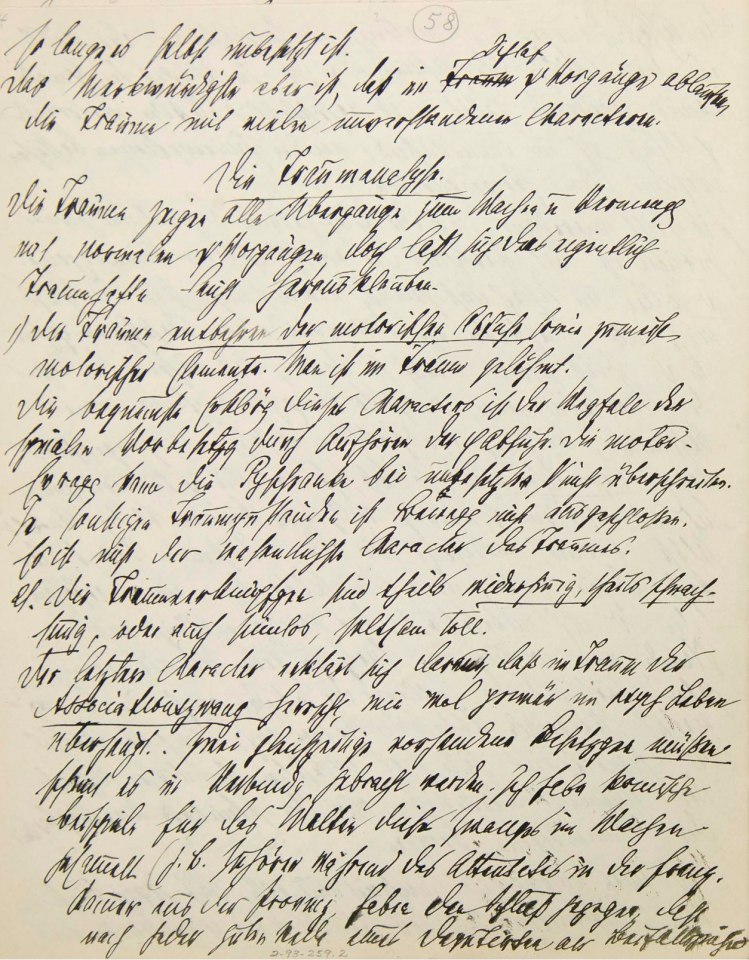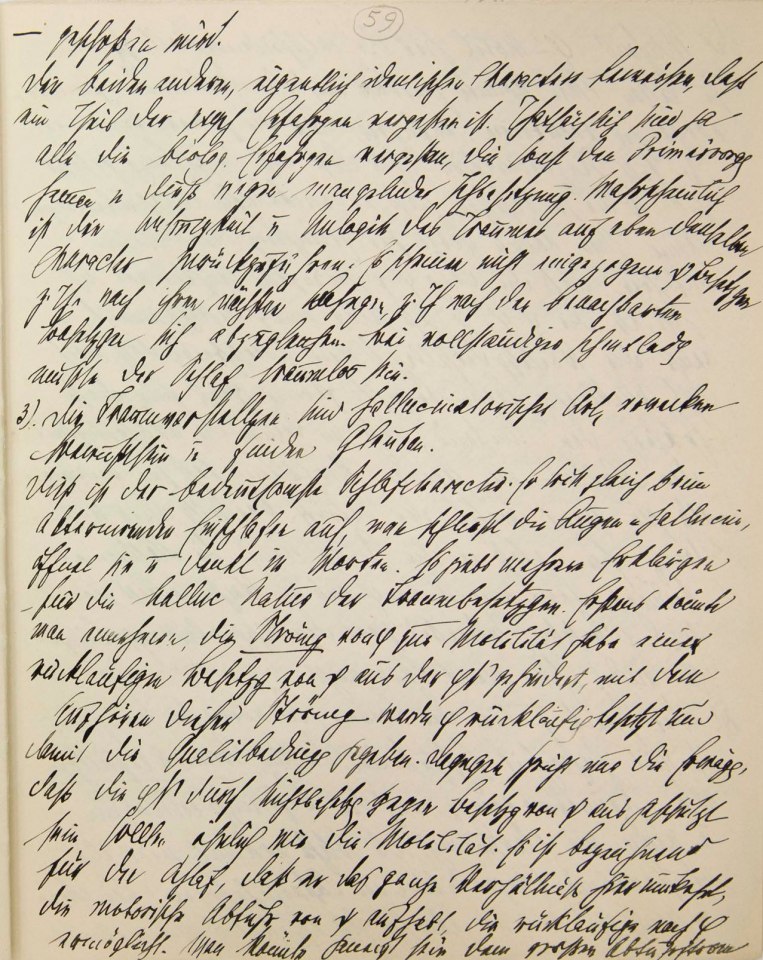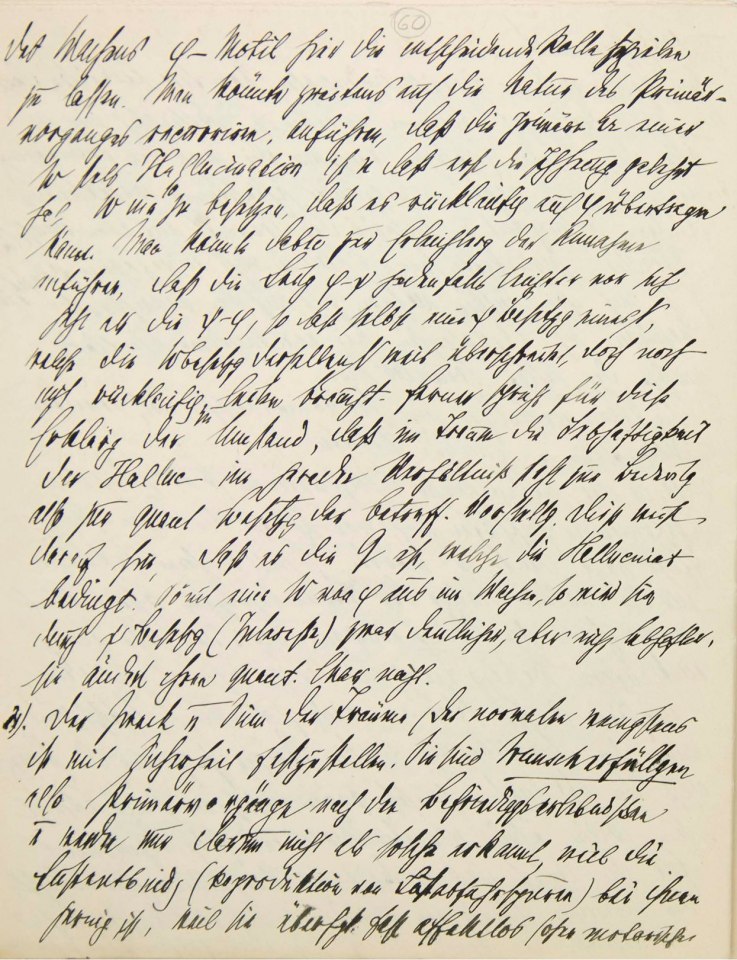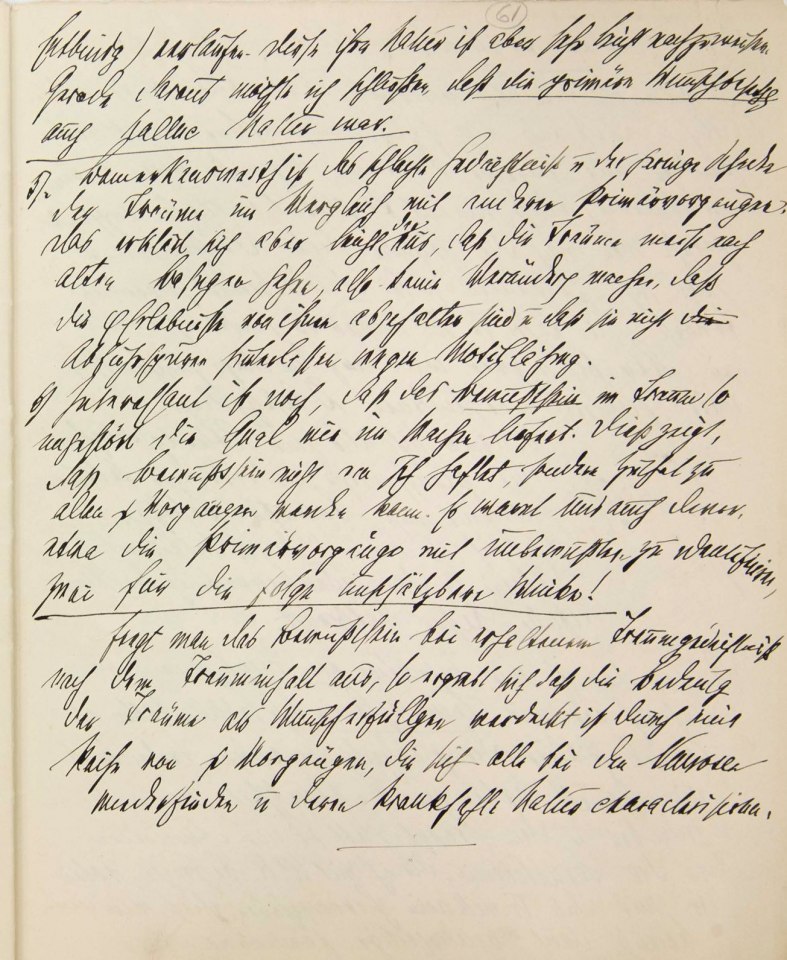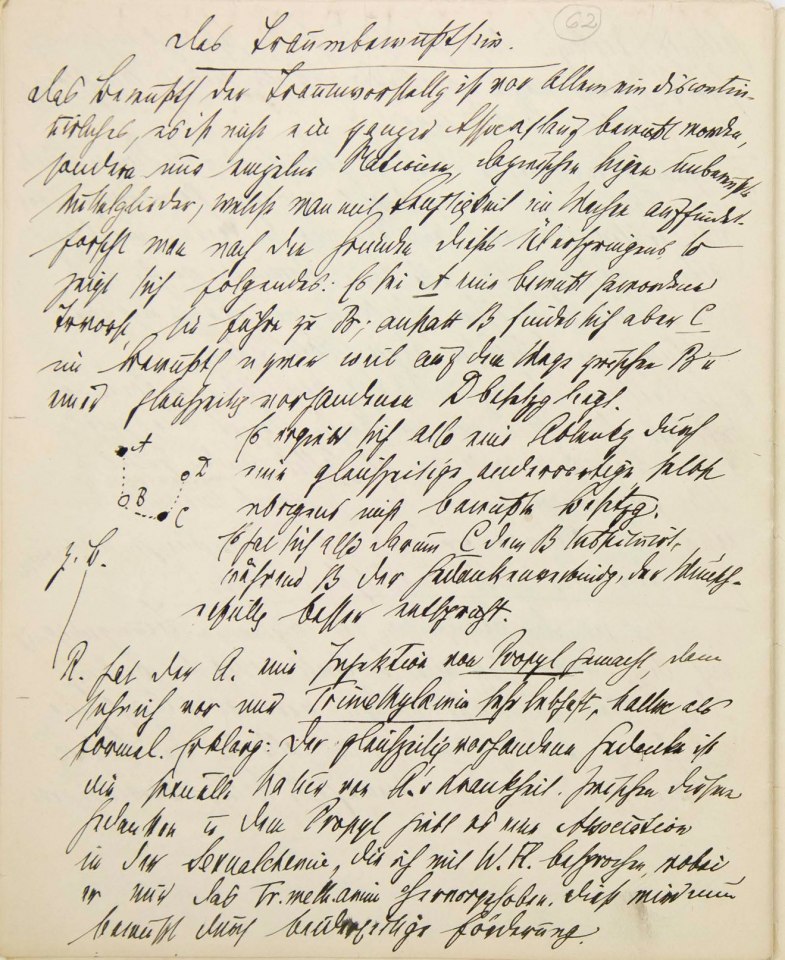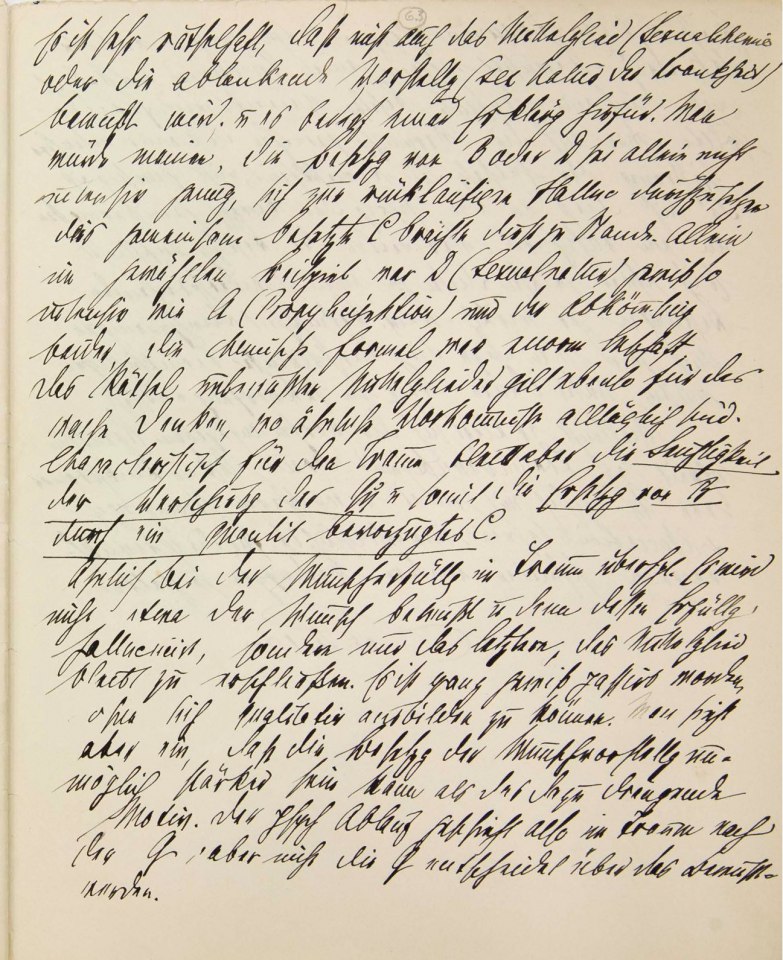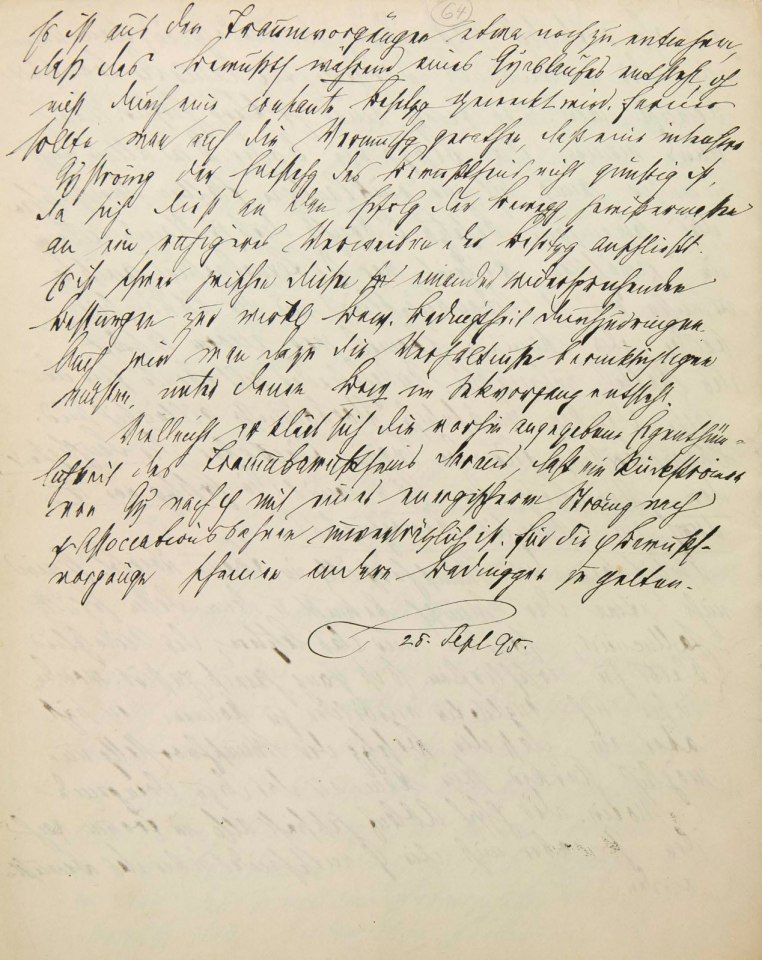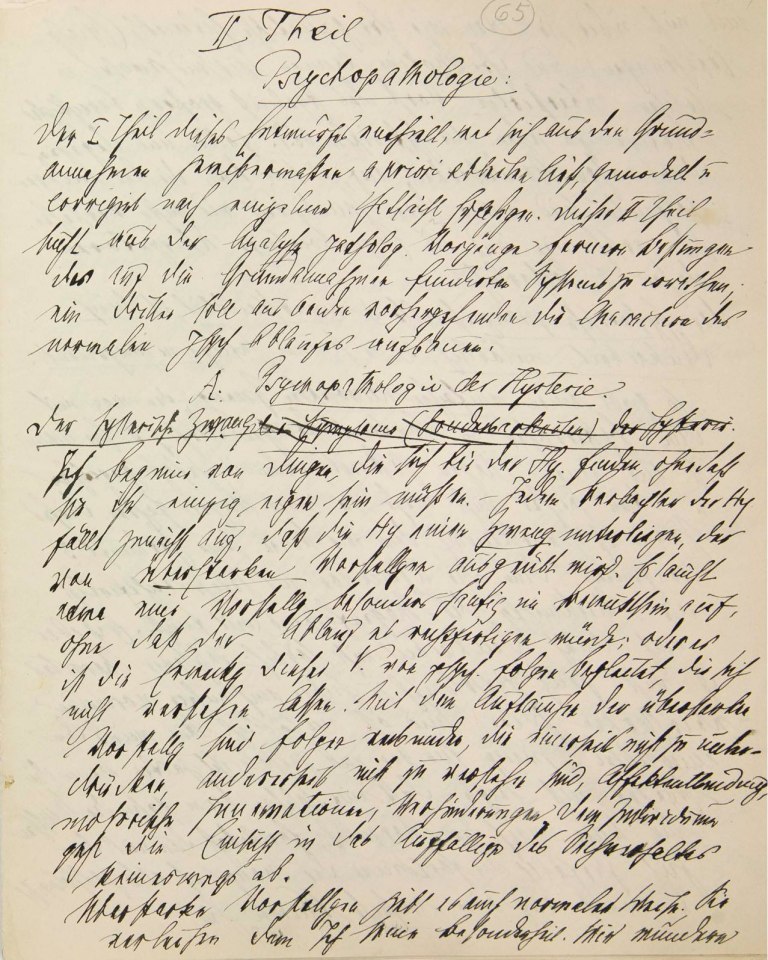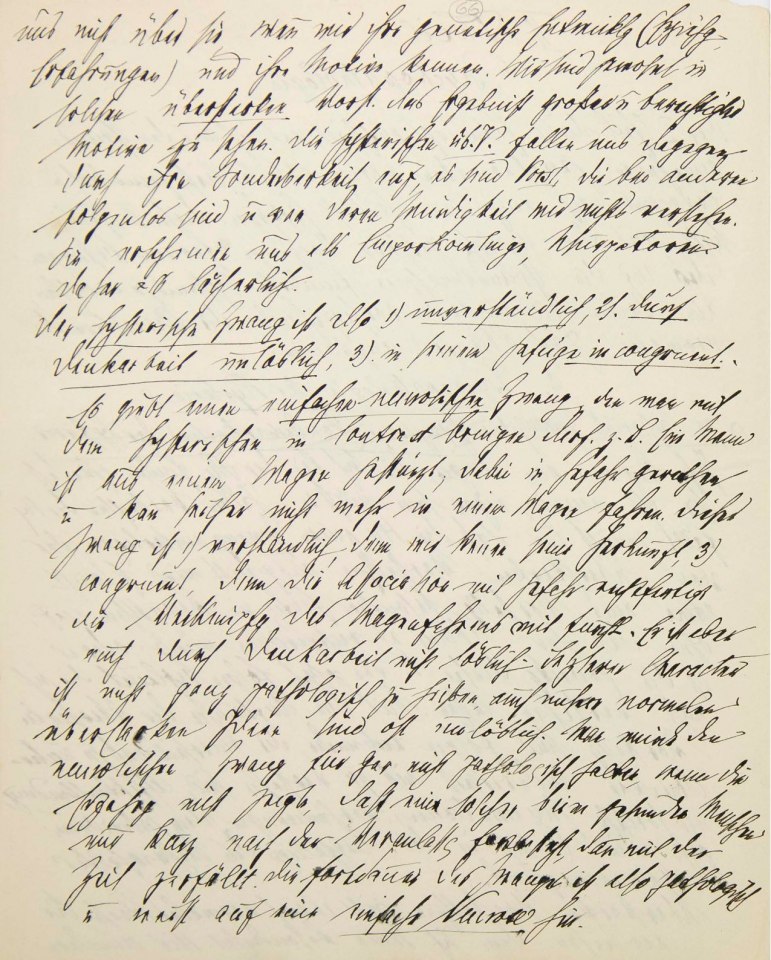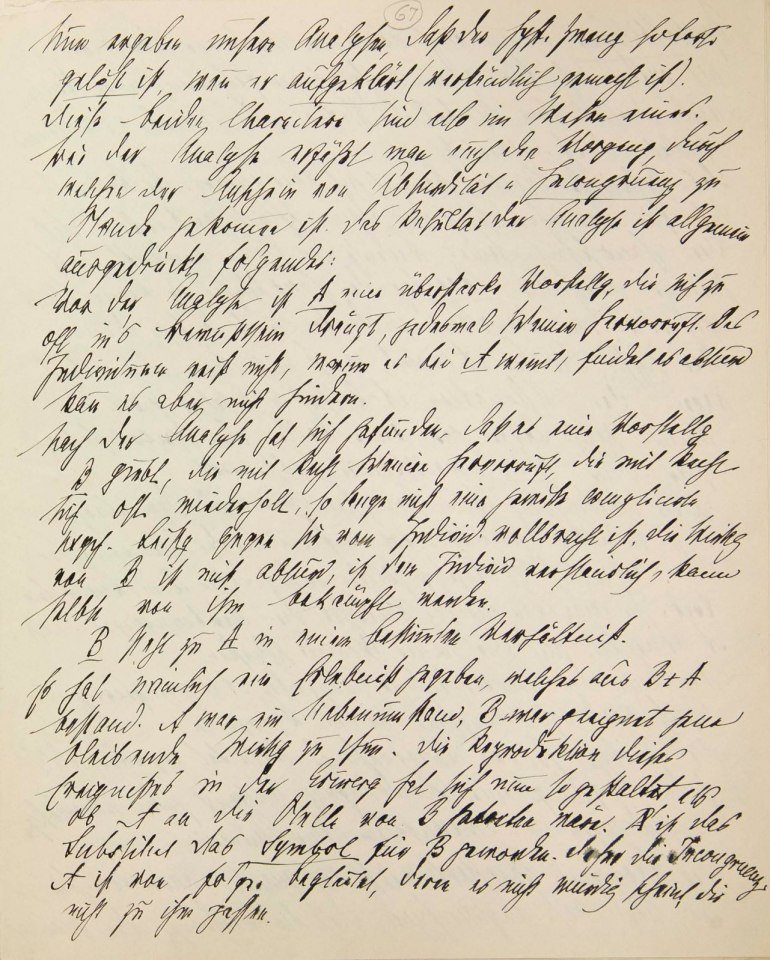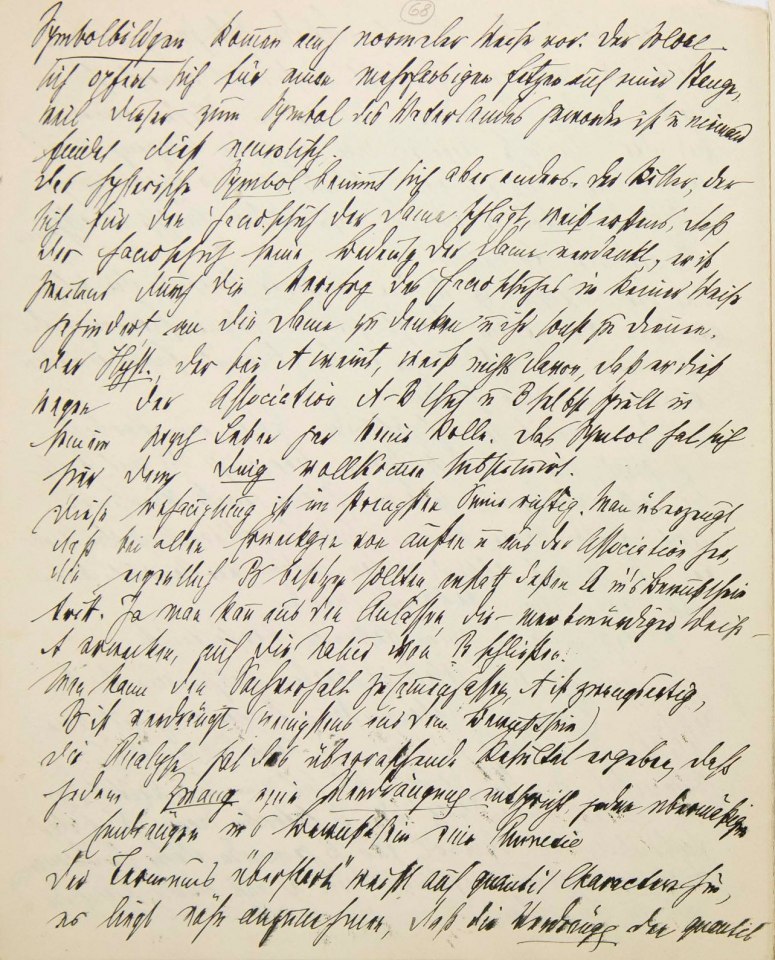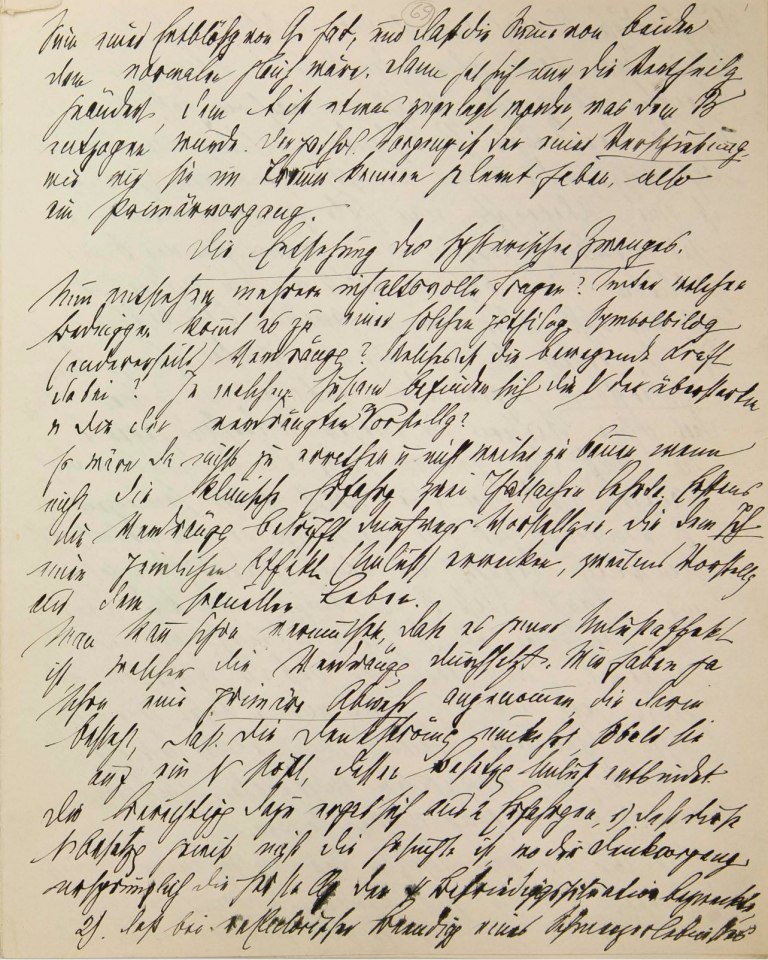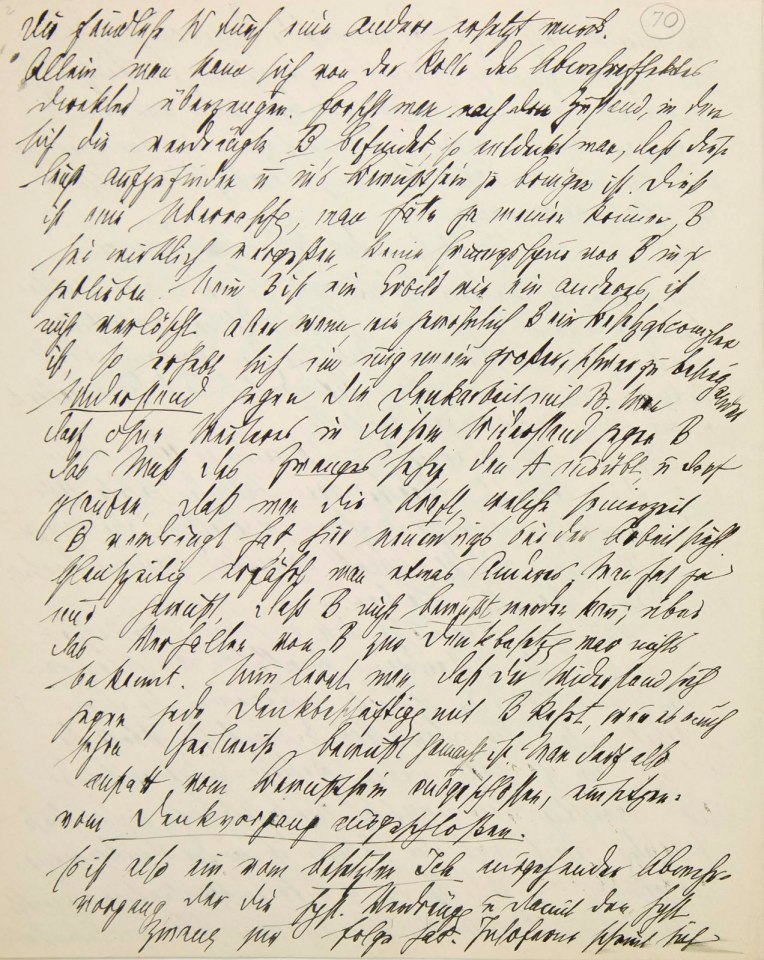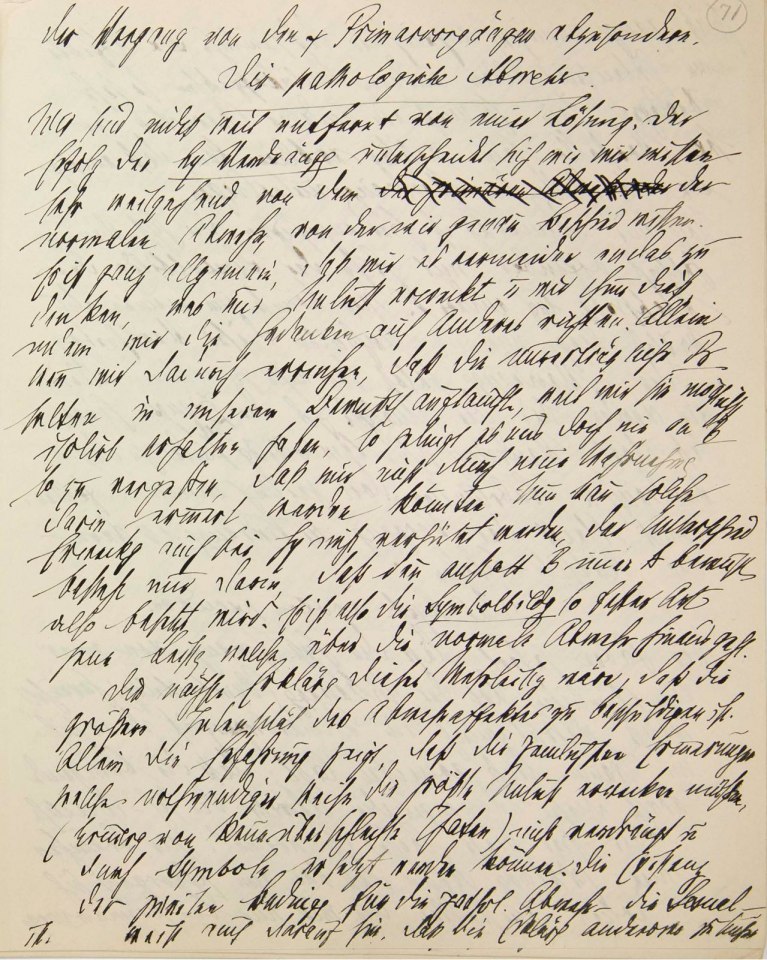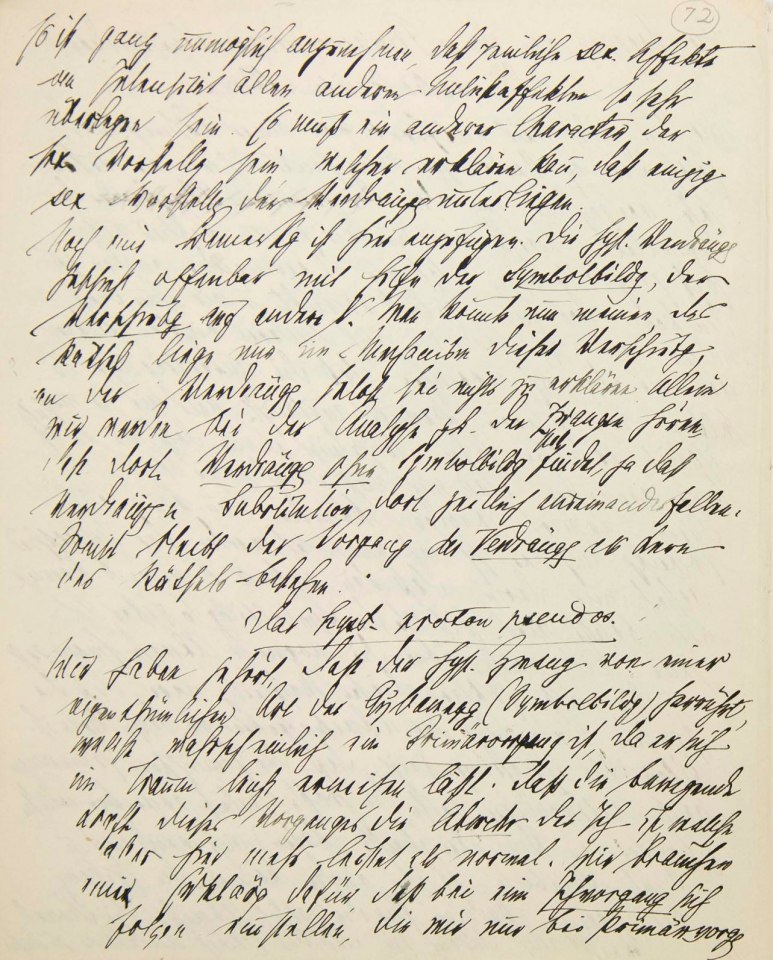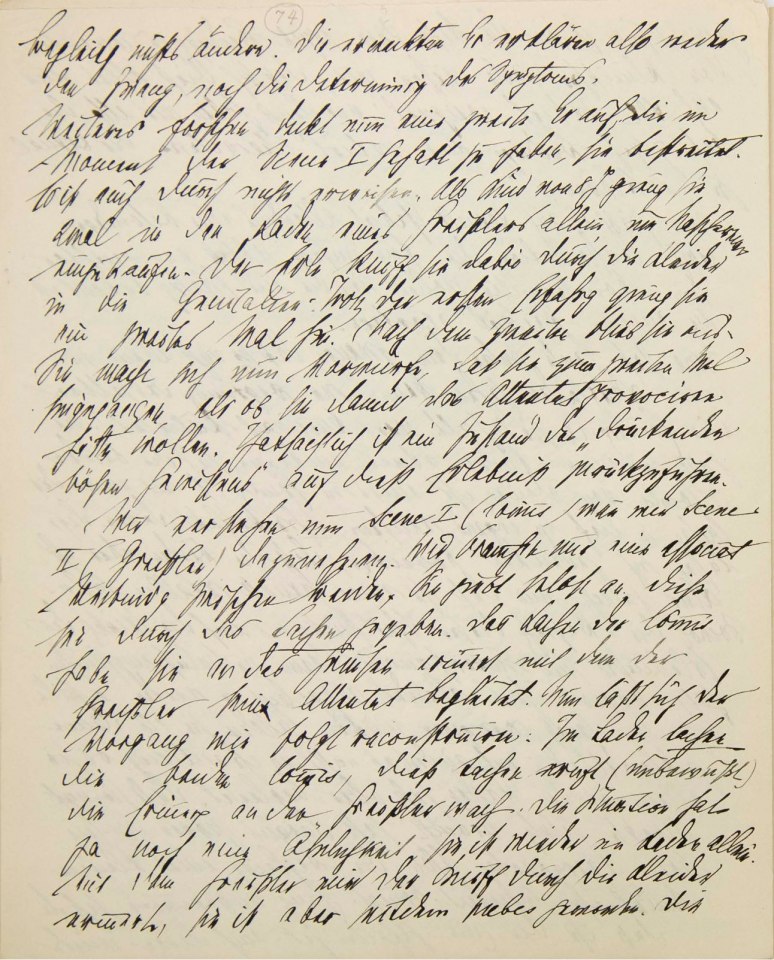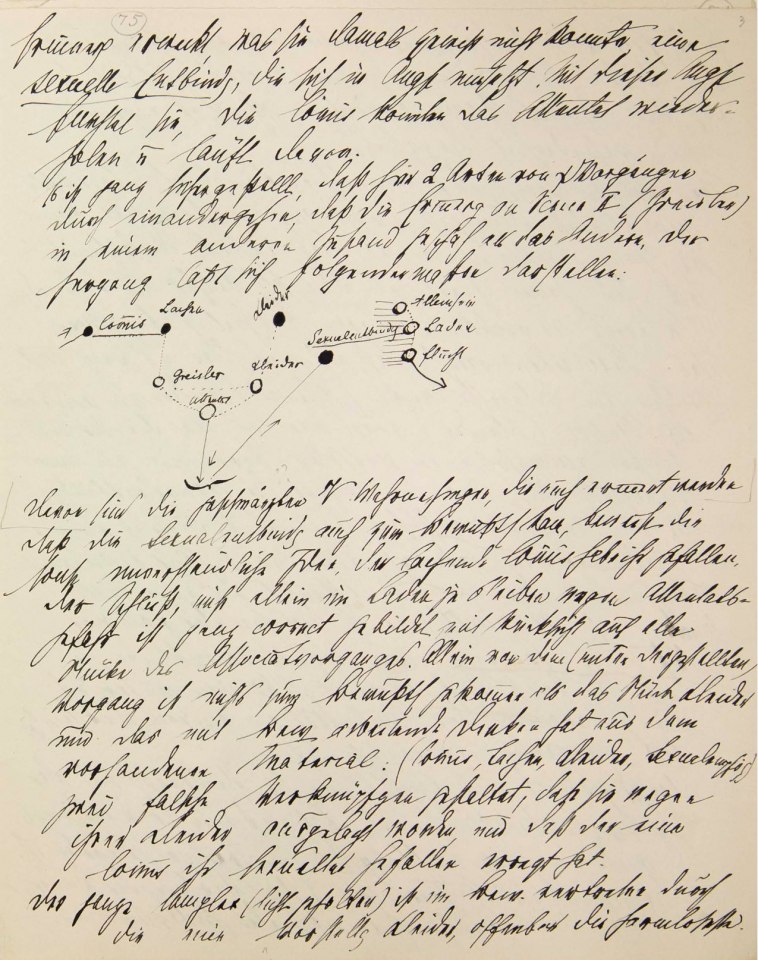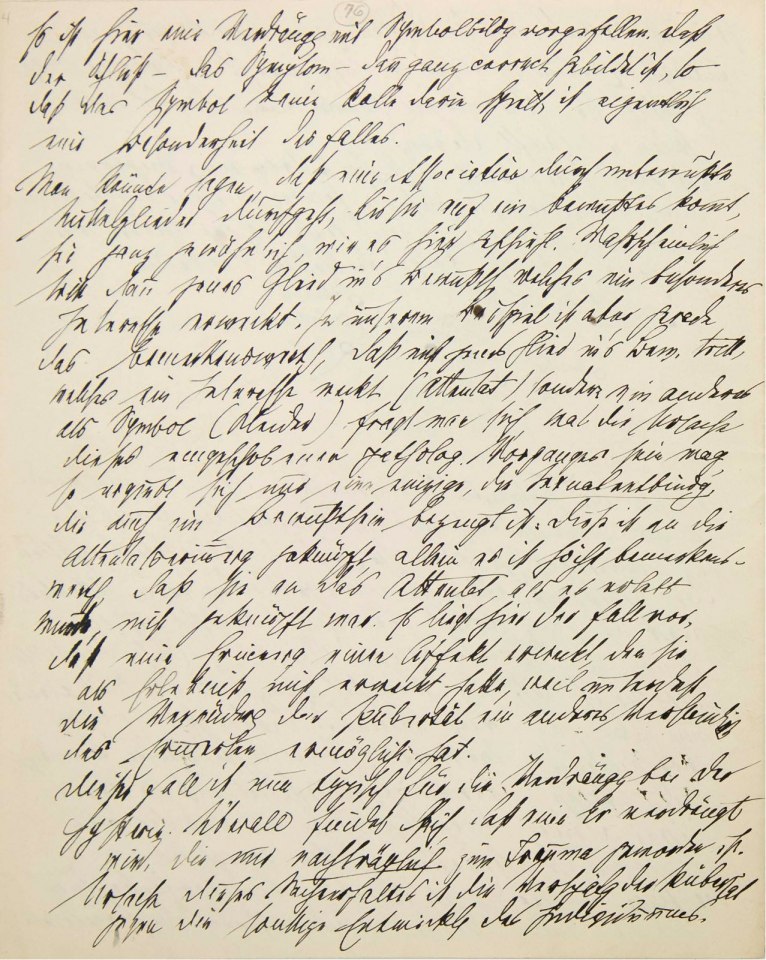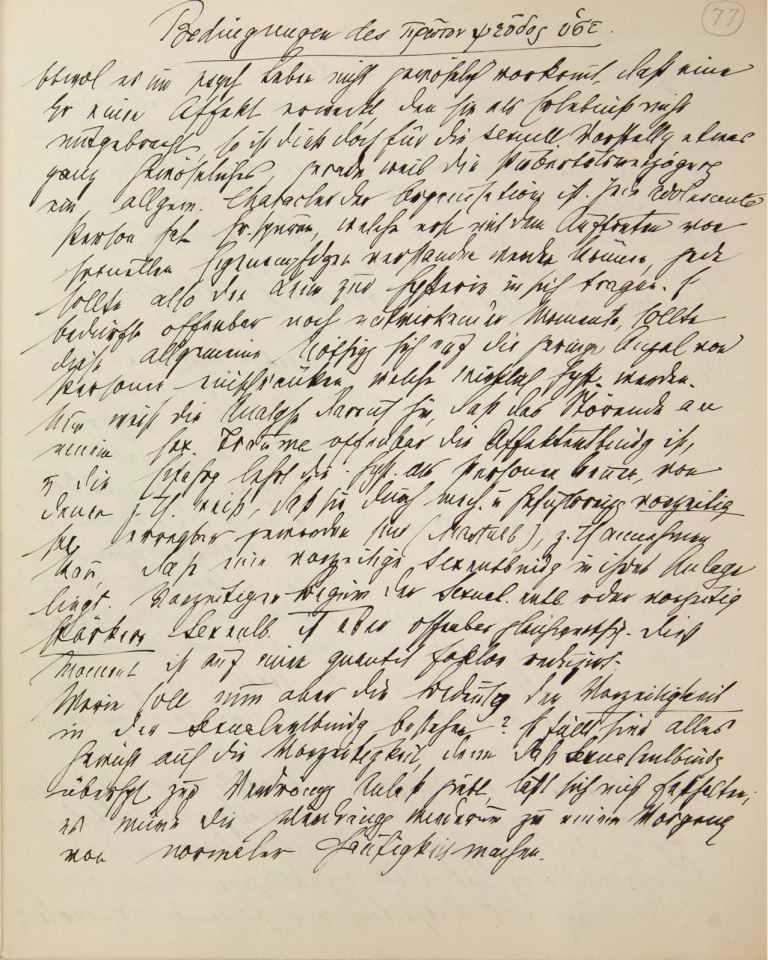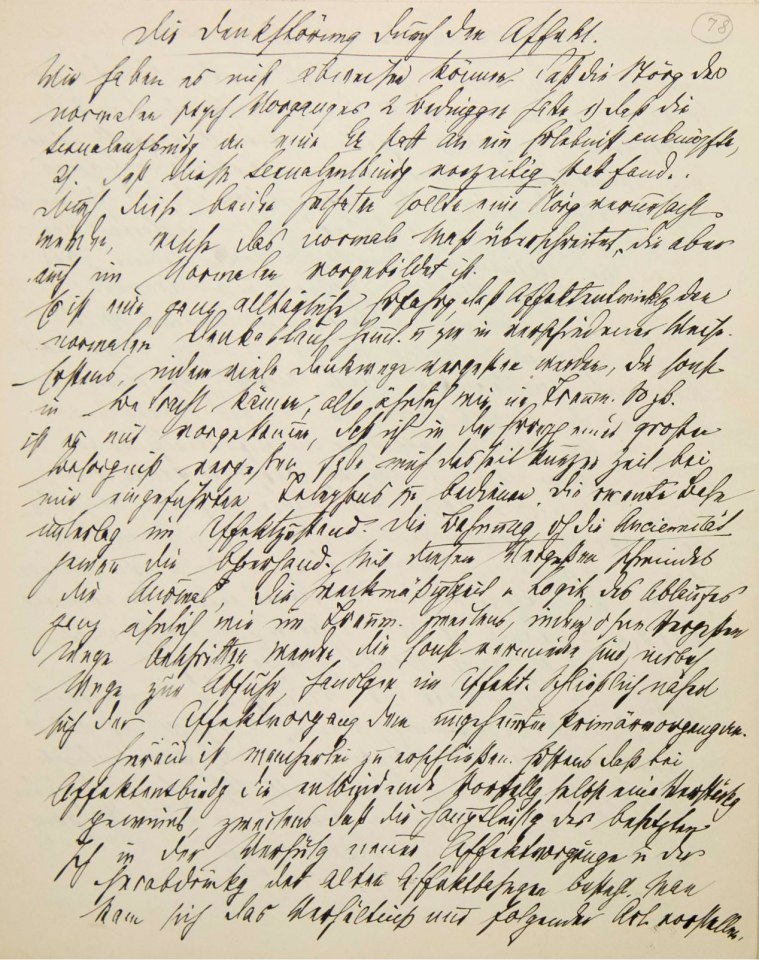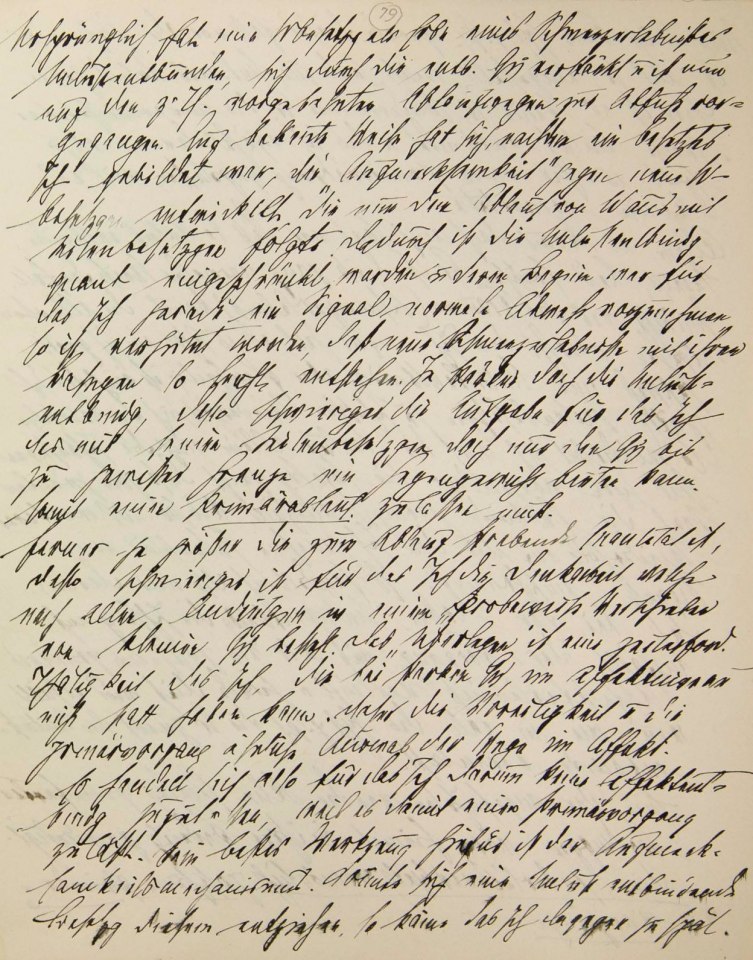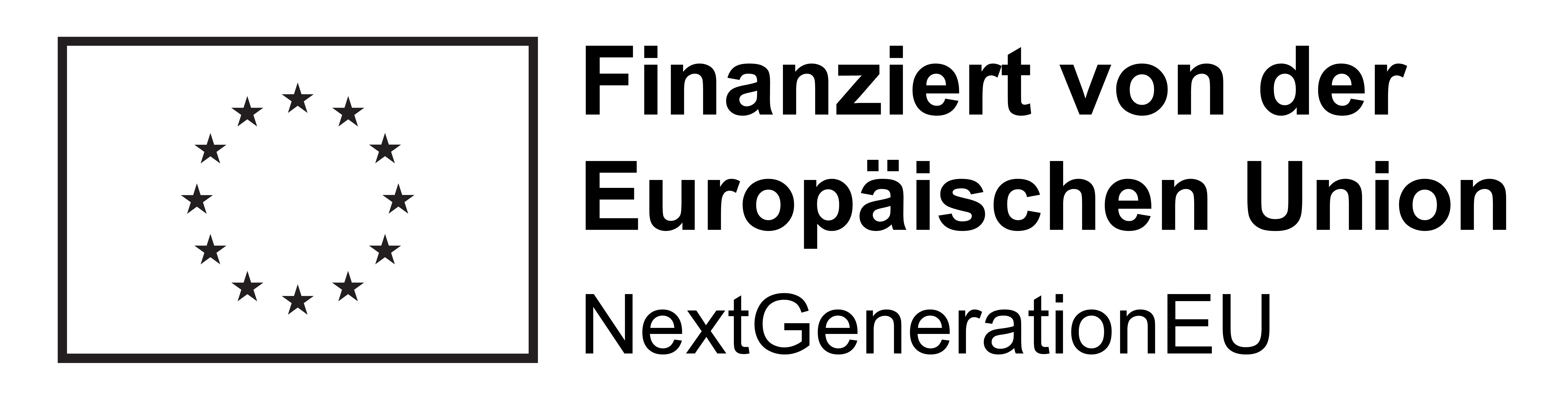S.
1
I. Teil
Allgemeiner Plan.
Einleitung
Absicht naturwissensch Psych zu liefern, dh psych
Vorgänge darstellen als quantit bestim̄te Zustän
aufzeigbarer materieller Theile, damit anschaulich u
widerspruchsfrei zu machen. Enthalten zwei HauptideenDas was Thätigkeit & Ruhe unterscheidet als Q aufzufassen
die allgemeinen Beweggsgesetz unterworfen, 2) als
materielle Theilchen die Neurone zu nehmen.N u Qἠ – Ahnliche Versuche jetzt häufig –
___________________________________________a) Erste Hauptsatz
Die quantitative Auffassung.
Sie ist direkt patholog. klinisch Beobachtg entnom̄en
besonders wo uberstarke Vorstellg handelte, Hysterie
Zwang, wobei wie sich zeigen wird der quantit
Character reiner als in normal hervortritt.Vorgänge Reiz Substitut, Conversion Abfuhr
die dort zu beschreiben waren, haben direk
die Auffassung der N.erregg als fließende
Quant nahe gelegt. Ein Versuch das hier Erkan̄te
verallgemeinern schien nicht unstatthaft.S.
2
Von dieser Betrachtg an ließ sich ein Grundprincip
der Nthätgkeit mit Beziehg auf die Q aufstellen
das viel Licht versprach, indem es die gesam̄te
Funktion umfaßen schien. Es ist dies Princip
der N-Trägheit, daß N sich Q zu entledigen
trachtet. Bau u Entwicklg sowie Leistgen
hiernach zu verstehenPrcp der Trägh erklärt zunächst Bau-Zweispältigk
in motor u sensibel, als Einrichtg die Qἠaufnahm
durch Abgabe aufzuheben. Die Reflexbewegg als
feste Form dieser Abgabe jetzt verständlich. Das
Princip giebt das Motiv f. d. Refelexb. Geht man
von hier aus weiter zurück, so hat man das
Nsy zuerst als Erbe der allgem Reizbarkeit
des Protopl mit der reizbar Außenfläche verknüpft
die durch größere Strecken unerregbarer
zersprengt ist. Ein primär Nsy bedient sich dieser
so erworbener Qἠ, um sie durch Verbindg an
die Muskelmaschinen abzugeben u erhält sich
so reizlos. Diese Abfuhr stellt die Primärf
des Nsy dar. Hier ist Platz für EntwicklgS.
3
Sekfunktion, indem unter Abfuhrwegen solche bevorzugt
u erhalten, mit denen Aufhören des Reizes verbunden
ist, Reizflucht. Hiebei besteht im Allgem Propor
zwischen Erregungsq u zur Reizfl nöthigen Leistg,
so daß das Träghprinzip hiedurch nicht gestört wird.Allein das Träghpr wird von Anfang durchbrochen durch anderes
Verhältniß. Mit Complexität des In̄eren nim̄t das Nsy Reize auf
aus Körperelement selbst, endogene Reize, die gleichfalls abge-
führt werden sollen. Diese entstam̄en Körperzellen u ergeben
die großen Bedürfniße, Hunger, Athem, Sexualität. Diesen
kan̄ sich der Org nicht entziehen wie den Außreizen, er
kan̄ ihre Q nicht zur Reizfl verwenden. Sie hören auf nur
unter bestim̄t Bedinggen, die in der Außenwelt realisirt
werden müßen. Z. B. Nahrgsbedürfniß. Um diese Aktion, die
specif genannt werden verdient, zu vollführ, bedarf es
einer Leistg, die unabhängig ist von endogen Qἠ, im Allgem
größer, da Individ unter Bedingg gesetzt, die man als
Noth des Lebens bezeichnen kann. Hiemit ist Nsy gezwung
die ursp Tendenz zur Trägheit dh zum Niveau = 0
aufzugeben. Es muß sich Vorrath von Qἠ gefallen
laßen, um Anforderg specif Aktion zu genügen.
In Art, wie dieß macht, zeigt sich indeß die
Fortdauer derselb Tendenz modificirtS.
4
zum Bestreben die Qἠ wenigstens möglichst niedrig
halten u sich gegen Steigerg zu wehren, dh constant
zu halten. Alle Leistgen des Nsy sind entweder
unter Gesichtsp der Primärf oder der Sekf
den durch Noth des Lebens aufgedrungen zu
bringen.Zweiter Hauptsatz.
Die Ntheorie
Der Gedanke mit dieser Qἠtheorie die Kenntniß
der N zu combiniren, wie sie die neuere
Histologie ergeben, ist zweiter Pfeiler dieser
Lehre. Hauptinhalt dieser neuen Erkenntniß
ist, daß das Nsy aus distinkten gleich gebauten
N besteht, die sich durch Vermittlg fremder
Masse berühren, die an ein ander endigen
wie an fremden Gewebstheilen, in denen
gewiße Leitgsrichtgen vorgebildet sind, indem sie
mit Zellforts aufnehmen, mit Axencyl
abnehmen. Dazu noch reichliche Verzweigg
mit Verschiedheit des Kalibers.Combinirt man diese Darstellg der N mit der
Auffassg der Qἠtheorie, so erhält man die
Vorstellg eines besetzten N, das mit gewißer
Qἠ gefüllt, andere Male leer sein kann.S.
5
Das Träghp findet seinen Ausdruck in Annahme
einer Strömg, die von Zelleib oder Fortsätzen
zum Ax gerichtet ist: Das einzelne N ist so Abbild
des gesamten Nsy mit seinem zwiespältigen Bau,
der Axcyl das Abfuhrorgan. Die Sekf aber
die Aufspeicherg von Qἠ verlangt, ist ermöglicht
durch die Annahme von Widerständen, die sich der
Abfuhr entgegensetzen und der Bau der N legt
es nahe die Widerstände sämtlich in
die Contacte zu versetzen, die hiedurch
den Wert von Schranken erhalten.Die Annahme der Cschr ist fruchtbar nach vielen
Richtungen.Die Contactschranken:
Die erste Berechtigung zu dieser Annahme entspringt
der Erwägg, daß hier die Leitung über undifferenzirtes
Protoplasma geht anstatt wie sonst in̄erhalb des N
über differenzirtes, wahrscheinlich zur Leitg besser
geeignet. Man bekom̄t so einen Wink, das Leitgs-
vermögen an die Differenzirg zu knüpfen, so daß
erwarten darf, durch den Leitungsvorgang selbst
werde eine Differenzirg im Protopl u damit ein
besseres Leitungsvermögen für fernere Leitungen
geschaffen.S.
6
Ferner läßt die Cschrtheorie folgend Verwerthgen
zu: Eine Haupteigenschaft des Nervengewebes ist das
Gedächtniß dh ganz allgemein die Fähigkeit durch
einmalige Vorgänge dauernd verändert zu werden.
was einen so auffälligen Gegensatz giebt zum Verhalten
einer Materie, die eine Wellenbewegg durchläßt
u darauf in ihren früheren Zustand zurückkehrt.Eine irgend beachtenswerte psychol. Theorie muß eine
Erklärg des „Gedächtnißes“ liefern. Nun stößt jede
solche Erklärg auf die Schwierigkeit, daß sie einerseits
annehmen muß, die N seien nach der Erregung dauernd
anders als vorher, während doch nicht geleugnet
werden kann, daß die neuen Erreggen im Allgemeinen
auf dieselben Aufnahmsbedinggen stoßen wie die
früheren. Die N sollen also sowol beeinflußt sein
als auch unverändert, unvoreingenom̄en. Einen Apparat,
der diese complicirte Leistg vermöchte, können
wir vor der Hand nicht aus denken; die Rettung
liegt also darin, daß wir die dauernde Beein-
flußung durch die Erregg einer Klasse von N zuschreiben,
die Unveränderlichkeit dagegen, also die Frische für
neue Erreggen einer anderen. So entstand die
gangbare Scheidg von „Wahrnehmungszellen“ und
„Erinnerungszellen“, die sich aber sonst in nichtsS.
7
einfügt selbst sich auf nichts berufen kann.
Wenn die Cschrtheorie sich diesen Ausweg aneignet, so
kan̄ sie ihm folgenden Ausdruck geben: Es giebt 2
Klassen von N, solche, die Qἠ durchlassen, als ob sie keine
Cschr hätten, die also nach jedem Erreggsablauf im
selben Zustande sind wie vorher, und 2) solche,
die deren Contactschr sich geltend machen, so daß
sie Qἠ nur schwer oder nur partiell durchlassen.
Solche können nach jeder Erregg im anderen Zustande
sein als vorher, ergeben also eine Möglichkeit, das
Gedächtniß darzustellen.Es giebt also durchlässige (keinen Widerstand leistende
u nichts retenirende) N, die der Wahrnehmg dienen
u undurchlässige (mit Widerstand behaftete u Qἠ zurück-
haltende), die Träger des Gedächtnißes, wahrscheinlich
also der psych. Vorgänge überhaupt sind. Ich will
das erstere System von Neuronen fortan φ, das
letztere ψ nennen.Es ist jetzt gut sich klarzumachen, welche Annahmen
über die ψ N nothwendig sind, um die allgemeinsten
Charactere des Gedächtnißes zu decken. Das Argument
ist: sie werden durch den Erreggsablauf dauernd
verändert. Mit Einfügg der Cschrtheorie: ihre Cschr
gerathen in einen dauernd veränderten Zustand.S.
8
Und da die psych Erfahrg zeigt, daß es ein Üben, Erlernen
giebt auf Grund des Gedächtnißes, muß diese Veränderg
darin bestehen, daß die Cschr leitungsfähiger, minder
undurchlässig werden, also denen des φ Systems ähnlicher.
Diesen Zustand der Cschr wollen wir als Grad der
Bahnung bezeichnen. Dan̄ kan̄ man sagen: Das Gedächtniß
ist dargestellt durch die zwischen den ψN vorhandenen
Bahnungen.Nehmen wir an, daß alle ψ Cschr gleich gut gebahnt wären
oder den gleichen Widerstand böten, was dasselbe ist,
so bekämen die Charaktere des Gedächtnißes offenbar
nicht heraus. Denn das Gedächtniß ist im Verhältniß
zum Erreggsablauf offenbar eine der bestimmenden
den Weg weisenden Mächte u bei überall gleicher
Bahng wäre eine Wegbevorzugung nicht einzusehen.
Man kan̄ daher noch richtiger sagen: Das Gedächtniß
sei dargestellt durch die Unterschiede in den
Bahnungen zwischen den ψ Neuronen.Wovon hängt nun die Bahnung in den ψN ab? Nach
der psych Erfahrg hängt das Gedächtniß, dh: die fort-
wirkende Macht eines Erlebnißes ab von einem
Faktor, den man die Größe des Eindrucks nen̄t,
und von der Häufigkeit der Wiederholg desselben
Eindrucks. In die Theorie übersetzt: Die Bahng hängt[Editorische Anmerkung:
Zeile 1: „Üben, Erlernen“
In GWN 392, findet sich „Über-Erlernen“
CD_2022-0510]S.
9
ab von der Qἠ, die im Erreggsvorgang durch das N läuft,
u von der Wiederholungszal des Vorganges. Dabei zeigt
sich also Qἠ als das wirksame Moment, die Quantität
u die Bahnung als Erfolg der Qἠ, gleichzeitig als das,
was die Qἠ ersetzen kann.Wie unwillkürlich denkt man hier an das ursprüngliche
durch alle Modifikationen festgehaltene Bestreben
des Nsy, sich die Belastung durch Qἠ zu ersparen
oder sie möglichst zu verringern. Durch die Not des Lebens
gezwungen hat das Nsy sich einen Qἠ-Vorrat anlegen
müßen. Dazu eine Vermehrg seiner N bedurft u diese
mußten undurchlässig sein. Nun erspart es sich die Erfüllg
mit Qἠ die Besetzung wenigstens theilweise, indem es
die Bahnungen herstellt. Man sieht also, die Bahngen dienen
der Primärfunktion.enNoch eines fordert die Anwendg der Gedächtnißforderg auf die
Cschrtheorie: Jedem ψN sind im Allgemeinen mehrere Verbindgs-
wege mit anderen N, also mehrere Cschr zuzuschreiben. Darauf
beruht ja die Möglichkeit der Auswal, die durch die
Bahng determinirt wird. Ganz einleuchtend jetzt, daß der
Bahngszustand der einen Cschr unabhängig sein muß
von dem aller anderen Cschr desselben ψN; sonst erhielte
sich wieder keine Bevorzugg, also kein Motiv. Hieraus
kan̄ man einen negativen Schluß ziehen auf die Natur
des „gebahnten“ Zustandes. Denkt man sich ein N mit Qἠ
erfüllt, also besetzt, so kan̄ man diese Q nur gleichmäßigS.
10
annehmen über alle Regionen des N, also auch über
alle Cschr derselben. Dagegen hat es keine Schwierigkeit
sich vorzustellen, daß bei strömender Qἠ nur ein
bestim̄ter Weg durch das N genom̄en wird, so daß nur
eine Cschr der Einwirkg der strömenden Qἠ unterliegt
u nachher davon Bahnung übrig behält. Es kann also
die Bahng nicht ihren Grund haben in einer zurückgehaltenen
Besetzg, dabei ergäben sich nicht die Unterschiede in
der Bahng der Cschr desselben N.Worin die Bahng sonst besteht, bleibt dahingestellt. Man
könnte zunächst denken: in der Absorption von Qἠ durch
die Cschr. Vielleicht fällt hierauf später Licht. Die Qἠ
die Bahng hinterlassen hat, wird wol abgeführt, gerade
in Folge der Bahnung, die ja durchlässiger macht. Es
ist übrigens nicht nothwendig, daß die Bahng, die nach
einem Qἠablauf bleibt, so groß ist, wie sie während
des Ablaufes sein mußte. Möglich, daß nur ein
Quotientbetrag davon als dauernde Bahng bleibt.
In soferne läßt sich auch noch nicht übersehen, ob es
gleichwertig ist, wen̄ eine Q:3ἠ auf einmal oder
eine Qἠ auf 3mal abläuft. All dies bleibt späteren
Anpassungen der Theorie an die psychischen Thatsachen
vorbehalten.S.
11
Der biologische Standpunkt.
Mit der Annahme zweier Nsysteme φ u ψ, von denen φ
aus durchlässigen, ψ aus undurchlässigen Elementen besteht,
scheint die eine Eigenthümlichkeit des Nsy, zu
u doch aufnahmsfähig zu bleiben, der Erklärg zugeführt
Alles psychische Erwerben bestünde dan̄ in der Gliederung des
ψ Systems durch theilweise u topisch bestim̄te Aufhebg
des Widerstandes in den Cschr, der φ und ψ unterscheidet.
Mit dem Fortschritt derselben hätte die Aufnahmsfrische
des Nsy thatsächlich eine Schranke gefunden.Indeß wird jeder, der sich mit Hypothesenbauen wissenschaftlich
beschäftigt, erst dann begin̄en, seine Aufstellungen ernst zu
nehmen, wenn sie von mehr als einer Seite her sich in das
Wissen einfügen lassen, u wenn sich die Willkürlichkeit
der Constructio ad hoc bei ihnen mildern läßt. Gegen
unsere Cschrhypothese wird eingewendet werden, daß sie 2
Klassen von N annim̄t mit fundamentaler Verschiedenheit
der Funktionsbedinggen, für welche Scheidg zunächst andere
Begründg. fehlt. Morphologisch wenigstens, dh histologisch, ist
keine Unterstützg dieser Sonderung bekannt.Woher soll man sonst einen Grund zu dieser Klassentheilg
nehmen? Wen̄ möglich aus der biologischen Entwickelg
des Nsy, das für den Naturforscher wie alles Andere
etwas allmählich Gewordenes ist. Man verlangt zu wissen,
ob die 2 Nklassen biologisch verschiedene Bedeutung gehabtS.
12
haben können, u wen̄ ja, durch welchen Mechanismus sie
sich zu den so verschiedenen Characteren der Durchlässigkeit
u Undurchlässigkeit entwickelt haben mögen. Natürlich
wäre es am meisten befriedigend, wenn der
gesuchte Mechanismus sich selbst aus der primitiven
biologischen Rolle ergäbe; man hätte dan̄ beide
Fragen mit einer Antwortgbehoben.Nun erin̄ern wir uns, daß das Nsy von Anfang an
2 Funktionen hatte, die Reize von Außen aufzunehmen,
u die endogen entstandenen Erreggen abzuführen.
Aus letzterer Verpflichtung ergab sich ja durch die Noth des
Lebens der Zwang zur weiteren biologisch Entwicklg.
Nun könnte man vermuten, unsere Systeme φ u ψ
seien es aber, die jedes eine dieser primären Ver-
pflichtgen auf sich genom̄en hätten. Das System φ sei
jene Gruppe von N, zu der die Außenreize gelangen,
das System ψ enthielte die N, welche die endogenen
Erreggen aufnehmen. Dan̄ hätten wir die beiden, φ u ψ, nicht
erfunden, sondern sie vorgefunden. Es erübrigt noch
sie mit Bekan̄tem zu identificiren.
Ken̄en wir aus der Anatomie ein System von N (das
Spinalgrau), welches allein mit der Außenwelt
zusam̄enhängt, und ein superponirtes (das Gehirngrau)
das keine direkten peripher Verbindgen hatS.
13
an dem aber die Entwicklg des Nsy und die psychischen
Funktionen haften. Das primäre Gehirn paßt nicht übel zu
unserer Characteristik des Systems ψ, wen̄ wir annehmen
dürfen, daß das Gehirn direkte u von φ unabhängige
Bahnen zum Körperin̄eren hat. Die Herkunft u ursprüngl
biologische Bedeutg des primären Gehirns ist nun den
Anatomen nicht bekannt; nach unserer Theorie wäre es
ein Sympathicusganglion direkt herausgesagt. Es ist hier
die erste Möglichkeit, die Theorie an thatsächlich
Material zu prüfen.Vorläufig halten wir das ψ System für identificirt mit
dem Gehirngrau. Man versteht nun leicht aus den einleitenden
biolog. Bemerkung, daß gerade ψ der Weiterentwicklung unterliegt
durch Nvermehrung und Qanhäufung u sieht auch ein, wie zweckmäßig
es ist, daß ψ aus undurchlässigen N besteht, da es sonst
den Anforderungen der spezif Aktion nicht nachkom̄en
könnte. Allein auf welchem Wege ist ψ zur Eigenschaft der
Undurchlässigkeit gekom̄en? φ hat doch auch Contactschranken,
wen̄ diese so gar keine Rolle spielen, warum die Cschr
von ψ? Die Annahme einer urspr Verschiedenheit in der
Wertigkeit der Cschr von φ u ψ hat wieder den mißlichen
Character von Willkür, obwol man sich jetzt nach
Darwinschen Gedankengängen auf die Unentbehrlichkeit u somit
das Überleben undurchlässiger N berufen könnte.S.
14
Ein anderer Ausweg scheint fruchtbarer u anspruchsloser
zu sein. Erin̄ern wir uns, daß auch die Cschr von ψ N
schließlich der Bahng unterliegen u daß es die Qἠ ist,
welche sie bahnt. Je größer die Qἠ im Erreggsablauf,
desto größer die Bahng, dh aber die Annäherg an
die Charactere von φN. Verlegen wir daher die
Unterschiede nicht in die N, sondern in die Quant, mit
denen sie zu thun haben. Dan̄ ist zu vermuthen, daß
auf den φN Quant ablaufen, gegen welche der Cschr-
widerstand nicht in Betracht kom̄t, daß aber zu den
ψN nur Quant gelangen, die von der Größenordnung
dieses Widerstandes sind. Dan̄ würde ein φN undurch-
lässig u ein ψN durchlässig werden, wen̄ wir ihre Topik
u Verbindungen vertauschen könnten; sie behalten aber
ihre Charactere, weil sie - das φN nur mit der Peripherie,
das ψN nur mit dem Körperin̄ern zusam̄enhängen.
Die Wesensverschiedenheit ist durch eine Schicksals-Milieu-
verschiedenheit ersetzt.Wir haben aber jetzt die Annahme zu prüfen, ob
man sagen darf, von der Außenperipherie gelangten
Reizquantit höherer Ordng zu den N als von der
In̄enperipherie des Körpers. Dafür spricht wirklich
mancherlei.S.
15
Zunächst keine Frage, daß die Außenwelt die Herkunft aller
großen Energiequantitäten ist, da sie nach physiß Erken̄tnis
aus mächtigen heftig bewegten Massen besteht, die ihre
Bewegg fortpflanzen. Das System φ, welches dießer Außen-
welt zugekehrt ist, wird die Aufgabe haben, die auf die N
eindringenden Qἠ möglichst rasch abzuführen, wird aber
jedenfalls der Einwirkg großer Q ausgesetzt sein.Das System ψ ist nach unserer besten Ken̄tnis außer Verbindg
mit der Außenwelt, es empfängt Q nur einerseits von den
φN selbst andere von den zelligen Elementen im Körper-
in̄ern u es handelt sich jetzt darum wahrscheinlich zu machen,
daß diese Reizq niedrigerer Größenordng sind. Es
stört vielleicht zuerst die Thatsache, daß wir den ψN zwei so
verschiedene Reizquellen wie φ und die Körperin̄enzellen
zuerken̄en müßen; allein gerade hier hilft uns die neuere
Histologie des Nsy in zureichender Weise. Sie zeigt,
daß Neuronendigg und Neuronverbindg nach demselben Typus
gebaut ist, daß die N an einander endigen wie an
den Körperelementen; wahrscheinlich ist auch das Funktionelle
beider Vorgänge gleichartig. Es wird sich wahrscheinlich
bei der Nervenendigg um ähnliche Quant handeln
wie bei der interzellulären Leitung. Wir dürfen
auch erwarten, daß die endogenen Reize von solcher
intraerzellulären Größenordnung sind. Im Übrigen eröffnet
sich hier ein zweiter Zugang zur Prüfg der Theorie.S.
16
Das Quantitätsproblem.
Ich weiß nichts über die absolute Größe intercellulärer
Reize, werde mir aber die Annahme gestatten, sie
seien von geringer Größenordnung u von derselben
wie die Widerstände der Cschr, was dan̄ leicht einsichtlich
ist. Mit dieser Annahme ist die Wesensgleichheit der
φ u ψ N gerettet u deren Verschiedenheit in Betreff der
Durchlässigkeit biologisch u mechanisch erklärt.An Beweisen ist hier Mangel, desto interessanter sind gewiße
Ausblicke und Auffassgen, die sich an obige Annahme
knüpfen. Zunächst, wen̄ man sich von der Größe der Q in
der Außenwelt den richtigen Eindruck geholt hat, wird
man sich fragen, ob die ursprüngliche Tendenz des Nsy, die Qἠ auf
0zu erhalten, den̄ ihr Genüge an der raschen Abfuhr
findet, ob sie sich nicht schon bei der Reizaufnahme
betätigt? Thatsächlich sieht man die φN nicht frei an
der Peripherie endigen, sondern unter Zellbildungen
die an ihrer Statt den exogenen Reiz aufnehmen.
Diese „Nervenendapparate" im allgemeinsten Sinn könnten
wohl den Zweck haben, die exogenen Q nicht unverringert
auf φ wirken zu lassen, sondern zu dämpfen. Sie hätten
dan̄ die Bedeutg von Q-Schirmen, durch die nur
Quotienten der exogenen Q durchgehen.S.
17
Dazu stim̄t es dann, wenn die andere Art der Nerven-
endigg, die freie, ohne Endorgane in der Körperin̄enperi-
pherie die bei Weitem bevorzugtere ist. Dort scheint
es keiner Q-Schirme zu bedürfen, wahrscheinlich weil die
dort aufzunehmenden Qἠ nicht erst die
auf das intercelluläre Niveau erfordern, sondern von vorne
herein so sind.Da man die Q berechnen kann, die von den
der φN aufgenom̄en werden, ergibt sich hier vielleicht ein
Zugang, sich von den Größen, die zwischen ψN ablaufen,
die also von der Art der Cschrwiderstände sind, eine Vor-
stellung zu verschaffen.Man ahnt hier ferner eine Tendenz, die etwa den Aufbau
des Nsy aus mehreren Systemen beherrschen mag: immer
weiter gehende Abhaltg von Qἠ von den N. Der Aufbau
also des Nsy dürfte der Abhaltung, die Funktion
der Abfuhr der Qἠ von den N dienen.Der Schmerz
Alle Einrichtungen biologischer Natur haben ihre Wirksamkeits-
schranken, außerhalb deren sie versagen. Dieß Versagen
äußert sich in Phänomenen, die ans Pathologische streifen,
sozusagen die Normalvorbilder für das Pathologische geben.
Wir haben das Nsy so eingerichtet gefunden, daß dieS.
18
großen äußeren Q von φ u noch mehr von ψ abge-
halten werden: die Nervenendschirme, die blos
indirekte Verbindg von ψ mit der Außenwelt. Gibt
es eine Erscheing, die sich zur Deckg bringen läßt mit dem
Versagen dieser Einrichtungen.? Ich glaube, es ist der
Schmerz.Alles was wir vom Schmerz wissen, stim̄t hiezu. Das Nsy hat
die entschiedenste Neigg zur Schmerzflucht. Wir erblicken
darin die Äußerg der primären Tendenz gegen die
Erhöhg der Qἠspan̄ung u schließen, der Schmerz bestehe
in dem Hereinbrechen großer Q nach ψ. Dan̄ sind
die beiden Tendenzen eine einzige. Der Schmerz setzt
das φ wie das ψ System in Bewegg, es gibt für ihn kein
Leitgshinderniß, er ist der gebieterischeste aller Vorgänge
Die ψN scheinen also durchlässig für ihn zu sein; er besteht
also in der Aktion von Q höherer Ordnung.Die Schmerzanlässe sind einerseits quantitat Steigerg; jede
sensible Erregg neigt zum Schmerz mit Zunahme des
Reizes, selbst der höchsten Sinnesorgane. Dies ist
ohne weiteres als Versagen zu verstehen. Anderer-
seits gibt es Schmerz bei geringen Außenquantit
u dieser ist dan̄ regelmäßig an Continuitätstren̄g
S.
19
gebunden, dh äußere Q, die auf die Enden der
φN direkt wirkt, nicht durch die Nervenendapparate,
ergibt Schmerz. Der Schmerz ist hiedurch characterisirt
als Hereinbrechen übergroßer Q nach φ u ψ, dh solcher
Q, die von noch höherer Ordng sind als die φReize.Daß der Schmerz alle Abfuhrwege geht, ist leicht
verständlich. In ψ hinterläßt er nach unserer Theorie
daß Q Bahng macht wol dauernde Bahngen, wie
wen̄ der Blitz durchgeschlagen hätte, Bahngen, die möglicher-
weise den Widerstand der Cschr völlig aufheben u
dort einen Leitgsweg etabliren, wie er in φ besteht.1Das Qualitätsproblem.
Es ist bisher gar nicht zur Sprache gekom̄en, daß jede psych.
Theorie außer den Leistgen von naturwissensch Seite her
noch eine große Anforderg erfüllen muß. Sie soll uns
erklären, was wir auf die rätselhafteste Weise durch
unser „Bewußtsein" ken̄en, u da dieß Bewußtsein
von den bisherigen Annahmen, Quantit u Neuronen – nichts
weiß, uns auch dieses Nichtwissen erklären.Sofort werden wir uns einer Voraussetzg klar, die uns
bisher geleitet hat. Wir haben die psychischen Vorgänge
als etwas behandelt, was dieser Kenntniß durch das
Bewußtsein entbehren könnte, was unabhängigS.
20
von einer solchen existirt. Wir sind darauf gefaßt, einzelne
unserer Annahmen nicht durch das Bewußtsein bestätigt
zu finden. Wen̄ wir uns darum nicht irre machen
lassen, so folgt dieß aus der Voraussetzg, das Bewußtsein
gebe weder vollständige noch verläßliche Kenntniß der
N-Vorgänge; dieselben seien im ganzen Umfang
zunächst als unbewußt zu betrachten u wie andere natürliche
Dinge zu erschließen.Dan̄ aber ist der Inhalt des Bewußtseins einzureihen in
unsere quantit ψ Vorgänge. Das Bewußtsein gibt uns,
was man Qualitäten heißt, Empfindungen, die in großer
Man̄igfaltigkeit anders sind u deren Anders nach
Beziehgen zur Außenwelt unterschieden wird. In diesem
Anders gibt es Reihen, Ähnlichkeiten udgl, Quantitäten
gibt es eigentlich darin nicht. Man kann fragen, wie
entstehen die Qualitäten u wo entstehen die Qualitäten?
Es sind Fragen der sorgsamsten Untersuchg bedürftig, über
die hier nur ungefähr gehandelt werden kann.Wo? entstehen die Qualitäten? In der Außenwelt nicht denn
nach unserer naturw Anschauung, der hier auch die Psychol
unterworfen werden soll, giebt es draußen nur bewegte
Maßen, nichts sonst. Im φ System etwa? Dem stim̄t zu,
daß die Qualit an die Wahrnehmg geknüpft sind, widersprichtS.
21
aber alles, was für den Sitz des Bewußtseins in oberen Etagen
des Nsy mit Recht geltend zu machen ist. Also im ψ-System. Dagegen
gibt es nun einen wichtigen Einwand. Bei der Wahrnehmg sind
das φ u das ψ System mitsam̄en thätig; es giebt nun einen psych
Vorgang, der sich wohl ausschließlich in ψ vollzieht, das Reproduzieren
oder Erin̄ern, u dieser ist allgemein gesprochen qualitätslos.
Die Erinnerung bringt de norma nichts von der besonderen Art der
Wahrnehmgsqualität zu Stande. So schöpft man Mut zur Annahme,
es gäbe ein drittes System von N, w etwa, welches bei der
Wahrnehmg mit erregt wird, bei der Reproduktion nicht, dessen
Erreggszustände die verschiedenen Qualitäten ergeben, dh bewußte
Empfindungen sind.Hält man fest, daß unser Bewußtsein nur Qualitäten liefert,
während die Naturwissenschaft nur Quantitäten anerkennt,
so ergibt sich wie aus einer Regel de tri eine Characteristik
der ω N. Während nämlich die Wissenschaft sich zur Aufgabe
gesetzt hat, unsere Empfindungsqualit. sämtlich auf äußere
Quantit zurückzuführen, ist vom Bau des Nsy zu erwarten,
daß es aus Vorrichtgen bestehe, um die äußeren Quant
in Qualit zu verwandeln, womit wieder die
Tendenz zur Abhaltung von Quantit siegreich erscheint.
Die Nervenendapparate waren ein Schirm, um nur Quotienten
der äußeren Quant zur Wirkg auf φ zuzulassen, während φ
gleichzeitig die grobe Quantabfuhr besorgt. Das System ψ
war vor höheren Ordngen von Quant bereits geschützt
hatte nur mit intercellulären Größen zu thun. In weiterer
Fortsetzg ist zu vermuthen, daß das System w von nochS.
22
geringeren Quant. bewegt wird. Man ahnt, es käme
der Qualitätscharacter (also die bewußte Empfindg) nur dort
zu stande, wo die Quant möglichst ausgeschaltet sind.
Ganz beseitigen läßt sie sich nicht, den̄ auch die ωN
müßen wir uns mit Qἠ besetzt und zur Abfuhr strebend
denken.Damit eröffnet sich aber eine anscheinend ungeheure Schwierigkeit.
Wir sahen, Durchlässigkeit hängt von der Einwirkg der Qἠ ab,
die ψN sind bereits undurchlässig. Bei noch kleinerer
Qἠ müßten die ωN noch undurchlässiger sein Allein diesen
Character können wir den Bewußtseinsträgern nicht lassen.
Zum Wechsel des Inhalts, zur Flüchtigkeit des Bewußtseins,
zur leichten Verknüpfg gleichzeitig wahrgenom̄ener Qualitäten
stim̄t nur volle Durchlässigkeit der ωN mit vollständiger
restitutio in integrum. Die ωN verhalten sich wie Wahrnehmgs-
organe, auch wüßten wir mit einem Gedächtniß derselben
nichts anzufangen. Also Durchlässigkeit, volle Bahnung,
die nicht von Quantit herrührt; wovon sonst?Ich sehe nur einen Ausweg, die Grundannahme über den
Qἠ-ablauf zu revidiren. Ich habe denselben bisher nur als
Übertragg von Qἠ von einem N zum anderen betrachtet. Er
muß aber noch einen Character haben, zeitlicher Natur
den̄ auch den anderen Massenbeweggen der Außenwelt
hat die Mechanik der Physiker diese zeitliche Characteristik
gelassen. Ich heiße dieselbe kurz: die Periode. So will ichS.
23
annehmen, daß aller Widerstand der Cschr nur für die Qüber-
tragg gilt, daß aber die Periode der Nbewegg sich ungehem̄t
überall hin fortpflanzt, gleichsam als Inductionsvorgang.Für physikalische Klärung ist hier sehr viel zu thun, denn die
allgemeinen Beweggsgesetze müßen auch hier widerspruchsfrei
zur Geltg kom̄en. Die Annahme geht aber weiter, daß
die ωN unfähig sind, Qἠ aufzunehmen, dafür sich die Periode
der Erregg aneignen, u daß dieser ihr Zustand von Affektion
durch die Periode bei geringster Qἠerfüllung das Fundament
des Bewußtseins ist. Auch die ψN haben natürlich ihre
Periode, allein, diese ist qualitätslos, besser gesagt:
monoton. Abweichgen von dieser psychischen Eigenperiode
kom̄en als Qualitäten zum Bewußtsein.Woher rühren die Verschiedenheiten der Periode? Alles
weist auf die Sinnesorgane hin, deren Qualitäten eben
durch verschiedene Perioden der Nbewegg dargestellt
werden sollen. Die Sinnesorgane wirken nicht nur als
Q-schirme wie alle Nervenendapparate, sondern auch
als Siebe, indem sie nur von gewißen Vorgängen mit
bestim̄ter Periode Reiz durchlassen. Wahrscheinlich übertragen
sie dan̄ auf φ diese Verschiedenheit, indem sie der
Nbewegg irgend analog verschiedene Perioden mittheilen
(specifische Energie) u diese Modificationen sind es, die
sich durch φ über ψ nach ω fortsetzen, u dort, wo sie f
ast quantitätsfrei sind, bewußte Empfindungen von
Qualitäten erzeugen. Haltbar ist diese Qualitätsfortpflanzg
nicht, sie hinterläßt keine Spuren, ist nicht reproduzierbar.S.
24
Das Bewußtsein
Nur durch solche complizierte u wenig anschauliche Annahmen
ist es mir bisher gelungen, die Phänomene des Bewußtseins
in den Aufbau der quantit Psychologie einbeziehen.
Eine Erklärg, wieso Erreggsvorgänge in den ωN – Bewußtsein
mit sich bringen, ist natürlich nicht zu versuchen. Es
handelt sich nur darum, die uns bekan̄ten Eigenschaften
des Bewußtseins durch parallel veränderliche Vorgänge
in den ωN zu decken. Das geht dan̄ im Einzelnen nicht
übel.Ein Wort über das Verhältniß dieser Bewußtseins-
theorie zu anderen. Nach einer vorgeschritten mechanistischen
Theorie ist das Bewußtsein eine bloße Zuthat zu den
physiologisch-psychischen Vorgängen, deren Wegfall am psych.
Ablauf nichts ändern würde. Nach anderer Lehre ist Bewußtsein
die subjektive Seite alles psychischen Geschehens, also untren̄bar
vom physiologischen Seelenvorgang. Zwischen beiden steht
die hier entwickelte Lehre. Bewußtsein ist hier die
subjektive Seite eines Theiles der physischen Vorgänge
im Nsy, nämlich der ω Vorgänge, und Wegfall des
Bewußtseins läßt das psychische Geschehen nicht unge-
ändert, sondern schließt den Wegfall des Beitrages
aus ω in sich ein.Stellt man das Bewußtsein durch ωN dar, so hat dieß
mehrere Folgerungen. Diese N müßen eine AbfuhrS.
25
haben, so klein sie sein mag, u es muß einen Weg geben,
die ωN mit Qἠ im geringen erforderlichen Betrag zu
erfüllen. Die Abfuhr geht wie jede nach der Seite der
Motilität, wobei zu bemerken ist, daß beim motorischen
Umsatz offenbar jeder Qualitätscharacter, jede Besonder-
heit der Periode verlorengeht. Die Qἠerfüllung
der ωN kan̄ wohl nur von ψ aus geschehen, da wir
diesem dritten System keine direkte Verknüpfung mit
φ zugestehen möchten. Was der
biologische Wert der ωN war, läßt sich nicht angeben.Wir haben aber bisher den Inhalt des Bewußtseins
unvollständig beschrieben; er zeigt außer den Reihen der
sinnlichen Qualitäten eine andere, davon sehr verschiedene
Reihe, die der Lust- u Unlust-empfindungen, die jetzt
der Deutung bedarf. Da uns eine Tendenz des psychischen
Lebens Unlust zu vermeiden sicher bekan̄t ist, sind
wir versucht diese mit der primären Trägheitstendenz zu
identificiren. Dann wäre Unlust zu decken mit Erhöhg des
Qἠ niveaus oder quantit Drucksteigerg, wäre die ω Empfindung
bei Qἠsteigerung in ψ. Lust wäre die Abfuhrempfindung.
Da w von ψ aus erfüllt werden soll, ergäbe sich die
Annahme, daß bei höherem ψ Niveau die Besetzg in
w zu –, bei fallendem Niveau dagegen abnimmt.
Lust u Unlust wären die Empfindgen der eigenen
Besetzung des eigenen Niveaus in w, wobei ω u ψ gewisser-
maßen com̄unicirende Gefäße darstellen. Auf solche
Weise kämen auch die quantit Vorgänge in ψ zum
Bewußtsein, wieder als Qualitäten.S.
26
Mit der Lust- u Unlustempfindg schwindet die Eignung
sinnliche Qualitäten wahrzunehmen, die sozusagen in
der Indifferenzzone zwischen Lust u Unlust liegen.
Es wäre dies zu übersetzen, daß die ωN bei einer gewißen
Besetzg ein Optimum zeigen die Periode der Nbewegg
aufzunehmen, bei stärkerer Besetzg Unlust ergeben
bei schwächerer Lust, bis die Aufnahmsfähigkeit mit
dem Mangel an Besetzg schwindet. Zu solchen Daten
wäre die entsprechende Bewegungsform zu construieren.––––––
Zweiter Theil
Das Functioniren des Apparates.
Man kann sich nun folgende Vorstellg von der Leistg
des aus φψω bestehenden Apparates bilden.Von außen dringen die Erreggsgrößen auf die Enden
des φsystems ein, stoßen zunächst auf die Nervendapparate
u werden durch diese auf Quotienten gebrochen,
welche wahrscheinlich höherer Ordng als Intercellularreize
sind (vielleicht doch derselben Ordng?). Es giebt hier
eine erste Schwelle; unterhalb einer gewißen Quantität
kom̄t ein wirksamer Quotient überhpt nicht zu Stande.
so daß die Wirkgsfähigkeit der Reize gewißermaßen
auf die mittleren Quantität beschränkt ist. Nebstbei
wirkt die Natur der Nervenddecken als Sieb,
so daß an den einzelnen Endstellen nicht Reize
jeder Art wirken können. Die auf φN wirklich
anlangenden Reize haben eine Quantität und
einen qualitativen Character, sie bildenS.
27
in der Außenwelt eine Reihe gleicher Qualität u wachsender
Quantität von der Schwelle an bis zur Schmerzgrenze.Während in der Außenwelt die Vorgänge ein Continuum
nach 2 Richtgen darstellen, der Quantität wie der Periode
(Qualität) nach, sind die ihnen entsprechenden Reize
der Quantität nach erstens reduzirt, zweitens durch einen
Ausschnitt begrenzt, der Qualität nach discontinuirlich
so daß gewiße Perioden gar nicht als Reize wirken.Außenwelt
Reize
Der Qualitätscharacter der Reize setzt sich nun ungehindert
durch φ über ψ nach ω fort, wo er Empfindg erzeugt
er ist dargestellt durch eine besondere Periode der N-
bewegg, die gewiß nicht die gleiche ist wie die des Reizes,
aber eine gewisse Relation zu ihr hat nach einer uns
unbekan̄ten Reduktionsformel. Diese Periode erhält
sich nicht lange, schwindet gegen die motorische Seite hin;
da sie durchgelassen wird, hinterläßt sie auch kein Gedächtniß.Die Quantität des φ Reizes erregt die Abfuhrtendenz
des Nervensystems, indem sie sich in proportionale
motorische Erregg umsetzt. Der Motilitätsapparat ist
direkte an φ gehängt, die so übersetzten Quantitäten
schaffen eine ihnen quantitat weit überlegene Wirkg
indem sie in die Muskeln, Drüsen udgl eingehen, also
dort durch Entbindg wirken, während zwischen den N
nur Übertragung stattfindet.S.
28
In den φN endigen ferner die ψN, auf welche ein
Theil der Qἠ übertragen wird, aber nur ein Theil
etwa ein Quotient, welcher einer intercellularen
Reizgroße entspricht. Es fragt sich hier, ob die auf
ψ übertragene Qἠ nicht proportional der in φ strömenden
Q wächst, so daß ein größerer Reiz eine stärkere
psych Wirkg ausübt. Hier scheint eine besondere
Einrichtg vorzuliegen, welche neuerdings Q von ψ
abhält. Die sensible ψ Leitg ist nämlich in eigen-
thümlicher Weise gebaut, sie verzweigt sich fort-
während u zeigt dickere u dün̄ere Bahnen, welche
in zahlreichen Endstellen ausgehen, wahrscheinlich von
folgender Bedeutung: Ein stärkerer Reiz geht andereI / II / II
α / β / γ
Wege als ein schwächerer. Qἠ z.B. wird
nur den Weg I gehen u bei der Endstelle
α einen Quotienten auf ψ übertragen. 2(Qἠ)
wird nicht in α den doppelten Quot übertragen,
sondern auch den Weg II gehen können, der enger
ist u eine zweite Endstelle nach ψ eröffnen, 3(Qἠ)
wird die engste Bahn [III] eröffnen u auch durch γ
übertragen. So wird die einzelne φ Bahn entlastet,
die größere Quantit in φ sich dadurch ausdrücken,
daß sie in ψ mehrere N anstatt eines einzigen
besetzt. Die einzelnen Besetzgen der ψN können
dabei ungefähr gleich sein. Wenn Qἠ in φ eine Besetzg
in ψ ergiebt, so drückt sich 3(Qἠ) aus durch
Besetzg in ψ1 + ψ2 + ψ3. Quantität in φ drückt
sich also aus durch Complication in ψ. Hiedurch
ist die Q von ψ abgehalten, bis zu gewißenS.
29
Grenzen wenigstens. Es erin̄ert dieß sehr an die Ver-
hältnisse des Fechner'schen Gesetzes, welches sich so
lokalisieren ließe.Auf solche Weise wird ψ von φ aus besetzt in Q, die
normaler Wei klein sind. Die Quantität der φ Erregung
drückt sich in ψ aus durch Complication, die Qualität
durch Topik, indem den anatomischen Verhältnißen nach
die einzelnen Sinnesorgane durch φ nur mit bestim̄ten
ψN in Verkehr stehen. ψ erhält aber noch Besetzg
vom Körperin̄ern aus u es geht wol an, sich die ψN
in zwei Gruppen zu zerlegen, die Mantelneurone
die von φ aus u die Kernneurone, die von den
endogenen Leitgen aus besetzt werden.Die ψ Leitungen.
Der Kern von ψ steht in Verbindg mit jenen Bahnen,
auf welchen endogene Erreggsq aufsteigen. Ohne daß
wir Verbindungen dieser Bahnen mit φ ausschließen
müssen wir doch die urspr Annahme festhalten, daß
ein direkter Weg vom Körperin̄ern zu ψN führt.
Dan̄ ist aber ψ auf dieser Seite den Q schutzlos ausgesetzt
u hierin liegt die Triebfeder des psych Mechanismus.Was wir von den endogenen Reizen wissen, läßt sich
in der Annahme ausdrücken, daß sie intercellulärer
Natur sind, continuirlich entstehen u nur periodisch
zu psych. Reizen werden. Die Idee einer Anhäufg ist
unabweislich u die Intermittenz der psych. Wirkg läßt
nur die Auffassg zu, daß sie auf ihrem Leitgsweg
nach ψ auf Widerstände stoßen, die erst bei Anwachsen
der Quantit überwunden werden. Es sind also LeitgenS.
30
mehrfacher Gliederung, mit Einschaltung mehrerer Contact-
schranken bis zum ψ Kern. Von einer gewissen Q an
wirken sie aber beständig als Reiz u jede Steigerg
derReizeQ wird als Steigerg des ψ Reizes wahrge-
nom̄en. Es giebt also dan̄ einen Zustand, in dem die
Leitung durchlässig geworden ist. Die Erfahrg lehrt
weiter, daß nach Abfuhr des ψ Reizes die Leitg
ihren Widerstand wiederaufnim̄t.Man heißt einen solchen Vorgang: Sum̄ation.
Die ψ Leitgen erfüllen sich durch Sum̄ation, bis sie
durchlässig werden. Offenbar ist es die Kleinheit des einzelnen
Reizes, welche die Sum̄ation gestattet. Sum̄ation ist
auch für die φ Leitgen, zB. für die Schmerzleitg nachge-
wiesen, sie gilt dort nur für kleine Quantit. Die
geringere Rolle der Sum̄ation auf der φ Seite spricht
dafür, daß es sich dort in der That um größere
Q handelt. Sehr kleine scheinen durch die Schwellen-
wirkg der Nervenendapparate abgehalten, während
auf der ψ Seite solche fehlen u nur kleine Qἠ wirken.Es ist sehr bemerkenswerth, daß die ψ Leitgsneurone
sich zwischen den Characteren der Durchlässigkeit u der
Undurchlässigkeit erhalten können, indem sie trotz des
Durchganges von Qἠ ihren Widerstand im vollen Umfang
beinahe wiederaufnehmen. Es widerspricht dieß
ganz der angenom̄enen Eigenschaft der ψN durch
strömende Qἠ dauernd gebahnt zu werden. Wie
läßt sich dieser Widerspruch aufklären?S.
31
Durch die Annahme, daß die Wiederherstellg des Widerstandes
bei Aufhören der Strömg allgemeine Eigenschaft der
Cschr ist. Diese läßt sich dan̄ unschwer mit der Beeinflussg
der ψN zur Bahng vereinen. Man braucht nur anzunehmen,
daß die Bahng, die nach dem Qablauf übrigbleibt
nicht in der Aufhebg eines jeden Widerstandes besteht,
sondern in der Herabsetzg desselben bis auf ein nothwendig
bleibendes Minimum. Während des Qablaufes ist der
Widerstand aufgehoben, nachher stellt er sich wieder her,
allein je nach der durchgelaufenen Q bis zu verschiedener
Höhe, so daß nächstes Mal bereits eine kleinere Q passiren
kann u dgl. Bei völligster Bahng bleibt dan̄ ein gewisser
für alle Cschr gleicher Widerstand, der also auch Anwachsen
von Q bis zu einer gewissen Schwelle fordert, damit
diese passire. Dieser Widerstand wäre eine Constante. Somit
bedeutet die Thatsache der Einwirkg der endogenen Qἠ
durch Sum̄ation weiter nichts, als daß diese Qἠ sich aus sehr
kleinen, unter der Constante befindlichen Größen von Erregg
zusaensetzt, die endogene Leitg ist darum doch vollkom̄en
gebahnt.Daraus folgt aber, daß die ψ Cschr im Allgemeinen höher reichen
als die Leitgsschranken, so daß in den KernN eine
neue Aufspeicherg von Qἠ erfolgen kann; dieser ist von
der Ausgleichg der Leitg an weiter keine Grenze gesetzt.
ψ ist hier der Q preisgegeben u damit entsteht im
Im̄ern des Systems der Antrieb, welcher alle psychische
Thätigkeit unterhält. Wir kennen diese Macht als den
Willen., den Abköm̄ling der Triebe.S.
[32]
Das Befriedigungserlebniss
Die Erfüllg der KernN in ψ wird ein Abfuhrbestreben, einen
Drang zur Folge haben, der sich nach motorischem Weg hin
entlädt. Der Erfahrg nach ist es die Bahn zur in̄eren Veränderg
(Ausdruck der Gemütsbewegg, Schreien, Gefäßinnervation), die
dabei zuerst beschritten wird. Alle solche Abfuhr wird aber
wie Eingangs dargelegt, keinen entlastenden Erfolg haben,
da die Aufnahme endogenen Reizes doch fortdauert
u die ψ Span̄g wiederherstellt. Reizaufhebg ist hier nur
möglich durch einen Eingriff, welcher im Körperin̄ern
die Qἠentbindg für eine Weile beseitigt, u dieser Eingriff
erfordert eine Veränderg in der Außenwelt (Nahrgs-
zufuhr, Nähe des Sexualobjektes), welche als specif. Aktion
nur auf bestim̄ten Wegen erfolgen kann. Der menschliche
Organismus ist zunächst unfähig, die spec. Aktion herbei-
zu führen. Sie erfolgt durch fremde Hilfe, indem
durch die Abfuhr auf dem Wege der in̄eren Veränderg
ein erfahrenes Individuum auf den Zustand des
Kindes aufmerksam gemacht. Diese Abfuhrbahn gewinnt
so die höchst wichtige Sekundärfunktion der Verständigg
und die anfängliche Hilflosigkeit des Menschen
ist die Urquelle aller moralischen Motive.S.
33
Wen̄ das hilfreiche Individ. die Arbeit der specif. Aktion
in der Außenwelt für das hilflose geleistet hat, so ist
dieses durch reflectorische Einrichtgen im Stande, die zur
endogenen Reizaufhebg nötige Leistg in seinem Körper-
in̄ern ohne Weiteres zu vollziehen. Das Ganze stellt dan̄
ein Befriediggserlebniß dar, welches die eingreifendsten
Folgen für die Funktionsentwicklg des Individ. hat.
Es geschieht nämlich 3erlei im ψ System. 1). Es wird dauernde
Abfuhr geleistet u damit dem Drang, der in ω Unlust erzeugt
hatte, ein Ende gemacht 2). es entsteht im Mantel die
Besetzung eines N (oder mehrerer), die der Wahrnehmg
eines Objektes entsprechen 3) es kom̄en in andere Stellen
des Mantels die Abfuhrnachrichten von der ausgelößt.
Reflexbewegg, die sich an die specif. Aktion anschließt.
Zwischen diesen Besetzgen u den KernN bildet sich dann
eine Bahnung.Die Reflexabfuhrnachrichten kom̄en dadurch zu Stande, daß jede
Bewegung durch ihre Nebenfolgen Anlaß zu neuen sensiblen
Erreggen (von Haut u Muskeln) wird, die in ψ ein „Bewegung-
bild" ergeben. Die Bahnung bildet sich aber auf eine
Weise, welche tieferen Einblick in die Entwicklg von ψ
gestattet. Bisher haben wir Beeinflußg von ψN durch φ
u durch endogene Leitgen kennengelernt; die einzelnen
ψN aber waren durch Cschr mit starken Widerständen
gegen einander abgesperrt. Nun gibt es ein Grundgesetz
der Association durch Gleichzeitigkeit, welches sich bei der
reinen ψ Thätigkeit, beim reproduzirenden Erin̄ern
bethätigt u das die Grundlage aller Verbindgen zwischen
den ψN ist. Wir erfahren, daß das Bewußtsein, also dieS.
34
quantit Besetzg von einem ψNα auf ein zweites β übergeht
wen̄ α u β einmal gleichzeitig von φ aus (oder sonst woher)
besetzt waren. Es ist also durch gleichzeitige Besetzg α-β ,eine
Cschr gebahnt worden. Hieraus folgt in den Ausdrücken
unserer Theorie, daß eine Qἠ aus einem N leichter
übergeht in ein besetztes als in ein unbesetztes.
Die Besetzg des zweiten N wirkt also wie die stärkere
Besetzg des ersten. Besetzg zeigt sich hier wiederum als
gleichwertig mit Bahnung für den Qἠablauf.Wir lernen also hier einen zweiten wichtigen Faktor für
die Richtg des Qἠablaufes ken̄en. Eine Qἠ im Neuron
α wird nicht nur nach der Richtg der am besten gebahnten
Schranke gehen, sondern auch nach der von der Gegenseite
besetzten. Die beiden Faktoren können einander unterstützen
oder eventuell einander entgegenwirken.Es entsteht also durch das Befriediggserlebniß eine Bahng
zwischen 2 Erin̄ergsbildern u den KernN, die im Zustand
des Dranges besetzt werden. Mit der Befriediggsabfuhr
strömt wohl auch die Qἠ aus den Erbildern ab. Mit Wieder-
auftreten des Drang- oder Wunschzustandes geht nun
die Besetzg auch auf die beiden Er über u belebt sie.
Zunächst wird wol das Objekterin̄ergsbild von der Wunsch-
belebung betroffen.Ich zweifle nicht, daß diese Wunschbelebg zunächst dasselbe
ergibt wie die Wahrnehmung, nämlich eine Hallucination.
Wird daraufhin die reflectorische Aktion eingeleitet,
so bleibt die Enttäuschung nicht aus.S.
35
Das Schmerzerlebniß.
ψ ist der Q normaler Weise ausgesetzt von den endogenen Leitgen
aus, in abnormer, wenngleich noch nicht patholog.r Weise für den
Fall, daß übergroße Q die Schirmvorrichtgen in φ durchbrechen,
also im Falle des Schmerzes. Der Schmerz erzeugt in ψ
1) große Niveausteigerung, die von ω als Unlust empfunden wird,
2). eine Abfuhrneigg, die nach gewissen Richtgen modificirt sein
kan̄, 3) eine Bahnung zwischen dieser u einem Erin̄ergsbild
des schmerzerregenden Objektes. Es ist überdieß keine Frage,
daß der Schmerz eine besondere Qualität hat, die sich
neben der Unlust geltend macht.Wird das Erbild des Objektes (feindlichen) irgendwie neu besetzt,
z B. durch neue W, soregrstellt sich ein Zustand her, welcher
nicht Schmerz ist, aber doch Ähnlichkeit mit ihm hat. Er enthält
Unlust und die Abfuhrneigg, die dem Schmerzerlebniß ent-
spricht. Da Unlust Niveausteigerung bedeutet, fragt es sich
nach der Herkunft dieser Qἠ. Im eigentlichen Schmerz-
erlebniß war es die hereinbrechende äußere Qἠ,
welche das ψ Niveau steigerte. In dessen Reproduktion
– dem Affekt – ist nur die Q hinzugekom̄en, die Er besetzt
u es ist klar, daß diese von der Natur einer jeden Wahr-
nehmg, nicht eine allgemeine Qἠsteigerung zur Folge
haben kann.Es bleibt also nur übrig, anzunehmen, daß durch die
Besetzg von Er Unlust aus dem Körperin̄eren entbunden
neu hinauf befördert wird. Den Mechanismus dieser
Entbindg kan̄ man sich nur in folgender Weise
vorstellen: Wie es motorische N gibt, die bei einer
gewißen Erfüllg Qἠ in die Muskeln leiten undS.
36
somit abführen, muß es „sekretorische" N geben, die, wen̄ sie
erregt sind, im Körperin̄ern entstehen lassen, was auf
die endogenen Leitgen nach ψ als Reiz wirkt, die also
die Produktion endogener Qἠ beeinflußen, somit nicht
Qἠ abführen, sondern auf Umwegen zuführen. Diese motorischen
N wollen wir „Schlüsselneurone" heißen. Sie werden
offenbar erst bei gewißem Niveau in ψ erregt. Durch
das Schmerzerlebniß hat das Er des feindlichen
Objektes eine vortreffliche Bahng zu diesen Schlüßel-
neuronen erhalten, kraft deren sich nun im Affekt
Unlust entbindet.Anlehng für diese befremdende aber unentbehrliche
Annahme gibt das Verhalten der Sexualentbindung.
Gleichzeitig drängt sich die Vermutung auf, die
endogenen Reize bestünden hier wie dort in chemischen
Produkten, deren Anzal eine erhebliche sein mag.
Da die Unlustentbindg bei ganz geringfügiger Besetzg
des feindlichen Er eine außerordentliche sein kann, darf
man schließen, daß der Schmerz ganz besonders
ausgiebige Bahnungen hinterläßt. Die Bahng, ahnt man
dabei, hängt durchwegs von der erreichten Qἠ ab, so
daß die bahnende Wirkg. von3 (Qἠ)3 Qἠ der von
3 × Qἠ weit überlegen sein könnte.S.
37
Affekte und Wunschzustände.
Die Reste der beiden behandelten Arten von Erlebnißen
sind die Affekte u die Wunschzustände, denen beiden
gemeinsam ist, daß sie eine Erhöhg der Qἠspannung in ψ
enthalten, im Affekt durch plötzliche Entbindung, im Wunsch
durch Sum̄ation hergestellt. Beide Zustände sind von der
größten Bedeutung für den Ablauf in ψ, da sie
zwangsartige Motive für denselben hinterlassen. Aus
dem Wunschzustand folgt geradezu eine Attraction nach dem
Wunschobjekt resp dessen Erbild, aus dem Schmerzerlebniß
resultirt eine Abstoßung, eine Abneigg, das feindliche
Er besetzt zu halten. Es sind dieß die primäre Wunschan-
ziehg u die primäre Abwehr.Die Wunschanziehg kan̄ man sich leicht durch die Annahme
erklären, daß die Besetzg des freundlichen Er im Begierde-
zustand an Qἠ die bei blosser Wahrnehmg erfolgte weit
übersteigt, so daß eine besonders gute Bahnu vom
ψ Kern zu dem entsprechenden N des Mantels führt.Schwieriger zu erklären ist die primäre Abwehr oder
Verdrängg, die Thatsache, daß ein feindliches Er stets so bald
als möglich von der Besetzg verlassen wird. Indeß dürfte
die Erklärg darin liegen, daß die primären Schmerzer-
lebniße durch reflectorische Abwehr zu Ende gebracht wurden.
Das Auftauchen eines anderen Objektes an Stelle des feindlichen
war das Signal dafür, daß das Schmerzerlebniß beendet
sei, und das ψ System versucht, biologisch belehrt, den Zustand
in ψ zu reproduziren, der das Aufhören des Schmerzes bezeichnete.S.
38
Mit dem Ausdrucke biologisch belehrt haben wir einen
neuen Erklärungsgrund eingeführt, der selbständige Geltg
haben soll, wenngleich er eine Zurückführg auf mechanische
Prinzipien (quantit Momente) nicht ausschließt sondern
erfordert. Im vorliegenden Falle kan̄ es leicht die bei
Besetzg von feindl Er jedesmal auftretende Qἠsteigerg
sein, die zur gesteigerten Abfuhrthätigkeit, somit zum
Abfluß auch von Er drängt.Einführung des „Ich".
Thatsächlich aber haben wir mit Annahme der „Wunschan-
ziehg" und der Neigg zur Verdrängg bereits einen
Zustand von ψ berührt, welcher noch nicht erörtert worden
ist; den̄ diese beiden Vorgänge deuten darauf hin, daß s
ich in ψ eine Organisation gebildet hat, deren Vorhanden-
sein Abläufe stört, die sich zum ersten Mal in bestim̄ter
Weise vollzogen haben. Diese Organisation heißt das
„Ich" u kan̄ leicht dargestellt werden durch die Erwägg,
daß die regelmäßig wiederholte Aufnahme endogener
Qἠ in bestim̄te N (des Kernes) u die bahnende Wirkg
die von dort ausgeht, eine Gruppe von N ergeben
wird, die constant besetzt ist, also dem durch die sek
Funktion erforderten Vorratsträger entspricht.
Das Ich ist also zu definiren als die Gesamtheit der
jeweiligen ψ Besetzgen, in denen sich ein bleibender
von einem wechselnden Bestandteil sondert.S.
39
Wie man leicht einsieht, gehören die Bahngen zwischen ψN
als Möglichkeiten in nächsten Momenten, dem veränderten
Ich seine Ausbreitg anzuweisen, mit zum Besitze des Ich.Während es das Bestreben dieses Ich sein muß, seine
Besetzgen auf dem Wege der Befriedigg abzugeben,
kan̄ es nicht anders geschehen, als daß es die Wiederholg
von Schmerzerlebnissen u Affekten beeinflußt, u zwar
auf folgendem Wege, der allgemein als der der Hem̄ung
bezeichnet wird:Eine Qἠ die von irgendwoher in ein N einbricht, wird sich
nach der Cschr der größten Bahng fortsetzen u eine
dorthin gerichtete Strömg hervorrufen. Genauer gesprochen,
es wird sich der Strom Qἠ im umgekehrten Verhältnis zum
Widerstand nach den einzelnen Cschr verteilen, u wo
dan̄ eine Cschr von einem Quotient getroffen wird, der
unter ihrem Widerstand liegt, da wird praktisch nichts
durchpassiren. Leicht kan̄ für jede Qἠ im N sich dieß Ver-
hältniß anders gestalten, da dan̄ Quotient entstehen, die
auch bei anderen Cschr die Schwelle überragen. So ist
der Ablauf abhängig von Qἠ und dem Verhältniß der
Bahnungen. Wir haben aber den dritten mächtigen Faktor
ken̄en gelernt. Wen̄ ein anstoßendes N gleichzeitig
besetzt ist, so wirkt dieß wie eine zeitweilige Bahng der
zwischen beiden liegenden Cschr u modificirt den Ablauf,
der sich sonst nach der einen gebahnten Cschr gerichtet hätte.
Eine Seitenbesetzg ist also eine Hem̄g für den Qἠablauf.S.
40
Stellen wir uns das Ich als ein Netz besetzter, gegen einander
gut gebahnter N vor, etwa so: So wird eine Qἠ, die vonγ
α / β / γ / δ
a / b
außen (φ) her in a eindringt u unbeein-
flußt nach dem Neuron b gegangen wäre,
durch die Seitenbesetzg in aα so beeinflußt,
daß sie nur einen Quotient nach b abgibt,
eventuell gar nicht nach b gelangt.
Wenn also ein Ich existirt, muß es psych Primärvorgänge
hem̄en.Solche Hem̄g ist aber ein entschiedener Vorteil für
ψ. Nehmen wir an, a sei ein feindl Er b eine SchlüßelN
zur Unlust, so würde primär bei Erweckg von a Unlust
entbunden wären, die vielleicht zwecklos wäre, es jedenfalls
ihrem vollen Betragx nach ist. Bei Hem̄ungswirkg von
α wird die Unlustentbindg sehr gering ausfallen, dem
Nsy Entwicklg u Abfuhr von Q ohne sonstigen Schaden
erspart. Man kann sich nun leicht vorstellen, daß mit
Hilfe eines Mechanismus, welcher das Ich auf die ankom̄ende
Neubesetzg des feindlichen Er aufmerksam macht, das Ich dazu
gelangen kann, durch ausgiebige nach Bedarf zu verstärkende
Seitenbesetzg den Ablauf von Er zur Unlustentbindg zu
hem̄en. Ja, wen̄ man annim̄t, daß die anfängliche Unlust-
(Qἠ)entbindg vom Ich selbst aufgenom̄en wird, so hat
man in ihr selbst die Quelle für den Aufwand, welchen
die hem̄ende Seitenbesetzg vom Ich erfordert.
Die primäre Abwehr ist dan̄ um so stärker, je stärker die Unlust.S.
41
Primär- und Sekundärvorgang in ψ.
Aus den bisherigen Entwicklgen folgt, daß das Ich in ψ,
welches wir seinen Tendenzen nach wie das Gesamtnervsystem
behandeln können, bei den unbeeinflußten Vorgängen
in ψ 2mal in Hilflosigkeit u Schaden geräth. Nämlich erstens,
wenn es im Wunschzustande die Objekt-Er neu besetzt
u dann Abfuhr ergehen läßt, wo dan̄ die Befriedigg
ausbleiben muß, weil das Objekt nicht real sondern
nur in Phantasievorstellg vorhanden ist. ψ ist zunächst
außer Stande, diese Unterscheidg zu treffen, weil es
nur nach der Folge analoger Zustände zwischen seinen
N arbeiten kann. Es bedarf also von anderswoher eines
Kriteriums, um Wahrnehmg und Vorstellg zu unterscheiden.Andererseits bedarf eines ψ eines Zeichens, um auf
die Wiederbesetzg des feindlichen Er aufmerksam zu
werden u der daraus folgenden Unlustentbindg durch
Seitenbesetzg vorzubeugen. Wen̄ ψ diese Hem̄g zeitig
genug vornehmen kann, fällt die Unlustentbindg u
damit die Abwehr geringfügig aus, im anderen
Falle gibt es enorme Unlust und excessive primäre
Abwehr.Die Wunschbesetzg wie die Unlustentbindg bei Neubesetzg der
betreffenden Er können biologisch schädlich sein. Die Wunsch-
besetzg ist es jedesmal, wen̄ sie ein gewisses Maß überschreitet
u so zur Abfuhr verlockt, die Unlustentbindg ist esS.
42
wenigstens jedesmal wen̄ die Besetzg des feindlichen Er
nicht von der Außenwelt, sondern von φ selbst aus
erfolgt (durch Association). Es handelt sich also auch hier
um ein Zeichen, W (Wahrnehmg) von Er (Vorstellung) zu
unterscheiden.Wahrscheinlich sind es nun die ωN, welche dieses Zeichen,
das Realitätszeichen, liefern. Bei jeder äußeren W
entsteht eine Qualitätserregg in ω, die aber zunächst
für ψ ohne Bedeutg ist. Es muß noch hinzugefügt werden,
daß die ω Erregg zur ω Abfuhr führt u von dieser
wie von jeder Abfuhr eine Nachricht nach ψ gelangt.
Die Abfuhrnachricht von ω ist dan̄ das Qualitäts- oder
Realitätszeichen für ψ.Wird das Wunschobjekt ausgiebig besetzt, so daß es
hallucinatorisch belebt wird, so erfolgt auch dasselbe
Abfuhr- oder Realitätszeichen wie bei äußerer W. Für
diesen Fall versagt das Kriterium. Findet aber die
Wunschbesetzg unter Hem̄ung statt, wie es bei besetztem
Ich möglich wird, so ist ein quantit Fall denkbar, daß
die Wunschbesetzg, als nicht intensiv genug, kein Qualitätsz
ergibt, während die äußere W es ergeben würde.
Für diesen Fall behält das Kriterium also seinen
Wert. Der Unterschied ist nämlich, daß das Qualz.
von außen her bei jeder Intensität der Besetzg erfolgt,
von ψ her nur bei großen Intensitäten. Es ist demnachS.
43
die Ichhem̄g, welche ein Kriterium zur Unterscheidg zwischen
W und Er ermöglicht. Biologische Erfahrg wird dan̄lehren,
die Abfuhr nicht eher einzuleiten, als bis das Realz
eingetroffen ist, u zu diesem Zwecke die Besetzg von den
erwünschten Er nicht über ein gewisses Maß zu treiben.Andererseits kan̄ die Erregg der ωN auch dazu dienen,
das ψ System im zweiten Falle zu schützen, dh indem ψ auf
die Thatsache einer W oder das Wegbleiben derselben
aufmerksam gemacht wird. Man muß zu diesem Zwecke
annehmen, daß die ωN ursprünglich in anatom Verbindg
mit der Leitg von den einzelnen Sinnesorganen stehen u
ihre Abfuhr wieder auf motor Apparate richten, die denselben
Sinnesorganen angehören. Dan̄ wird die letztere Abfuhrnachricht,
(die der reflectorischen Aufmerksamkeit) für ψ biologisch
ein Signal werden, nach denselben Richtgen Besetzgsquantität
zu schicken.Also: bei Hem̄g durch besetztes Ich werden die ω Abfuhrzeichen
ganz allgemein zu Realitätszeichen, welche ψ biologisch
verwerten lernt. Befindet sich das Ich bei Auftauchen eines
solchen Realz im Zustande der Wunschspan̄g, so wird es
die Abfuhr nach der specif Aktion folgen lassen; fällt mit
dem Realz eine Unluststeigerg zusam̄en, so wird ψ durch
geeignet große Seitenbesetzg am angezeigten Orte eine
Abwehr von normaler Größe veranstalten; ist keines
von beiden der Fall, so wird die Besetzg ungehindert
nach den Bahngsverhältnissen vor sich gehen dürfen.S.
44
Die Wunschbesetzg bis zur Hallucination, die volle Unlust-
entwicklg, die vollen Abwehraufwand mit sich bringt,
bezeichnen wir als psychische Primärvorgänge; hingegen
jene Vorgänge, welche allein durch gute Besetzg des Ich
ermöglicht werden u Mäßigg der obigen darstellen, als
psychische Sekundärvorgänge. Die Bedingg der letzteren
ist wie man sieht, eine richtige Verwerthung der Realz
die nur bei Ichhem̄g möglich ist.Das Erken̄en u reproduzirende Denken.
Nachdem wir die Annahme eingeführt haben, daß beim
Wunschvorgang die Ichhem̄g eine gemäßigte Besetzg
des gewünschten Objektes herbeiführt, welche gestattet es als
nicht real zu erkennen, dürfen wir die Analyse dieses
Vorganges fortsetzen. Es können sich mehrere Fälle
ereignen. Erstens: gleichzeitig mit der Wunschbesetzg des Er
ist die W desselben vorhanden; dan̄ fallen die beiden
Besetzgen übereinander, was biologisch nicht verwertbar
ist, es entsteht aber außerdem das Realz von ω aus,
nach welchem erfahrungsgemäß die Abfuhr erfolgreich
ist. Dieser Fall ist leicht erledigt. Zweitens: die
Wunschbesetzg ist vorhanden, daneben eine W, die nicht
ganz sondern nur theilweise mit ihr übereinstim̄t.
Es ist nämlich Zeit sich zu erin̄ern, daß die Wbesetzgen
nie Besetzgen einzelner N sind, sondern stets von Complexen.S.
45
Wir haben diesen Zug bisher vernachlässigt; es ist jetzt an der
Zeit ihm Rechnung zu tragen. Die Wunschbesetzg betreffe
ganz allgemein Na + Nb, die Wbesetzg Na + Nc. Da dieß
der häufigere Fall sein wird, häufiger als der der Identität,
erfordert er genauere Erwägg. Die biologische Erfahrg wird
auch hier lehren, daß es unsicher ist Abfuhr einzuleiten,
wenn die Realz nicht den ganzen Complex sondern nur
einen Theil davon bestätigen: Es wird aber jetzt ein Weg
gefunden, die Ähnlichkeit zur Identität zu vervollkom̄nen.
Der W-Complex wird sich durch den Vergleich mit anderen
W-Complexen zerlegen in einen Bestandtheil Na eben
der sich meist gleichbleibt u in einen zweiten, Nb, der
zumeist variirt. Die Sprache wird später für diese Zerlegg
den Terminus Urtheil aufstellen und die Ähnlichkeit
herausfinden, die zwischen Kern des Ich u dem constanten
Wbestandtheil, den wechselnden Besetzgen im Mantel
u dem inconstanten Bestandtheil tatsächlich vorliegt,
wird Na das Ding und Nb dessen Thätigkeit oder Eigenschaft
kurz dessen Praedikat benen̄en.Das Urtheilen ist also ein ψ Vorgang, welchen erst die Ichhem̄g
ermöglicht, u der durch die Unähnlichkeit zwischen der Wunschbesetzg
eines Er und einer ihr ähnlichen Wbesetzg hervorgerufen wird.
Man kan̄ davon ausgehen, daß das Zusam̄enfallen beider Besetzgen
zum biologischen Signal wird, den Denkakt zu beenden u die
Abfuhr eintreten zu lassen. Das Auseinanderfallen gibt den
Anstoß zur Denkarbeit, die wieder mit dem Zusam̄enfallenS.
46
beendet wird.
Man kan̄ den Vorgang weiter analysieren: Wenn Na zusam̄enfällt,
Nc aber anstatt Nb wahrgenom̄en wird, so folgt dieIcharbeit
den Verbindungen dieses Nc u läßt durchBesetzgStrömg von
Qἠ längs dieser Verbindgen neue Besetzgen auftauchen
bis sich ein Zugang zu dem fehlenden Nb findet. In der Regel
ergibt sich ein Beweggsbild, welches zwischen Nc und Nb eingeschaltet
ist, und mit der Neubelebg dieses Bildes durch eine
wirklich ausgeführte Bewegg ist die W von Nb u damit die
gesuchte Identität hergestellt. Z. B. das gewünschte Er sei
das Bild der Mutterbrust u ihrer Warze in Vollansicht,
die erste W sei eine Seitenansicht desselben Objektes ohne
die Warze. In der Erin̄erg des Kindes befindet sich eine
Erfahrg, beim Saugen zufällig gemacht, daß mit einer
bestim̄ten Kopfbewegg das Vollbild sich in das Seitenbild
verwandelt. Das nun gesehene Seitenbild führt auf die
Kopfbewegg, ein Versuch zeigt, daß ihr Gegenstück
ausgeführt werden muß, u die W der Vollansicht ist
gewonnen.Hierin ist noch wenig vom Urtheil, allein es ist ein Beispiel
von der Möglichkeit durch Reproduktion von Besetzgen
auf eine Aktion zu kom̄en, welche bereits zum
accidentellen Schenkel der specifisch. Aktion gehört.Es ist kein Zweifel, daß es Qἠ aus dem besetzten Ich
ist, welche diesen Wandergen längs der gebahnten NS.
47
unterliegt, und daß diese Wanderg nicht von den Bahngen
sondern von einem Ziel beherrscht wird. Welches ist dieses
Ziel u wie wird es erreicht?Das Ziel ist, zu dem vermißten Nb zurückzukehren u die
Identitätsempfindg auszulösen, dh den Moment, in dem nur
Nb besetzt ist, die wandernde Besetzg in Nb einmündet. Es
wird erreicht durch probeweises Verschieben der Qἠ auf
allen Wegen u es ist klar, daß hiezu bald ein größerer
bald ein geringerer Aufwand von Seitenbesetzg nötig
ist., je nachdem man sich der vorhandenen Bahngen bedienen
kan̄ oder ihnen entgegenwirken muß. Der Kampf zwischen den
festen Bahngen u den wechselnden Besetzgen characterisirt
den Sekundärvorgang des reproduzirenden Denkens im
Gegensatz zur primären Associationsfolge.Was leitet auf dieser Wanderg? Daß die Wunschvorstellg
Er besetzt gehalten wird, während man von Nc die
Associationen verfolgt. Wir wissen, daß durch solche
Besetzg von Nb alle seine etwaigen Verbindgen selbst
gebahnter u zugänglicher werden.Auf dieser Wanderg kann es geschehen, daß die Qἠ auf eine
Er stößt, die mit einem Schmerzerlebniß in Beziehg steht
u somit Anlaß zur Unlustentbindg gibt. Da dies ein
sicheres Anzeichen ist Nb sei auf diesem Wege nicht zu
erreichen,erlenkt sich der Strom sofort von der betreffenden
Besetzg ab. Die Unlustbahnen behalten aber ihren hohen
Wert, um den Reproduktionsstrom zu dirigiren.S.
48
Das Erin̄ern u das Urtheilen.
Das reproduz Denken hat also einen praktischen Zweck u ein
biologisch festgestelltes Ende, nämlich eine von der¿überschüßigen
W aus wandernde Qἠ auf die vermißte Nbesetzg zurückzuführen.
Dan̄ ist Identität u Abfuhrrecht erreicht, wen̄ noch das Realiz.
von Nb auftritt. Es kann aber der Vorgang sich vom letzten
Ziel unabhängig machen u nur die Identität anstreben.
Dan̄ hat man einen reinen Denkakt vor sich, der aber
in jedem Falle später praktisch verwertbar gemacht
werden kann. Auch benim̄t sich das besetzte Ich dabei in
völlig gleicher Weise.Wir folgen einer dritten Möglichkeit, die sich im Wunschzu-
stande ereignen kann, daß nämlich bei vorhandener
Wunschbesetzg eine auftauchende W gar nicht mit dem gewünschten
Er (Er +) zusam̄enfällt. Dann entsteht ein Interesse, dieses W
zu erkennen, um eventuell doch von ihm einen Weg zu
Er + zu finden. Es ist anzunehmen, daß zu diesem Zwecke
W auch vom Ich aus überbesetzt wird1, wie im vorigen Falle
los der Bestandtheil Nc. Wen̄ nicht absolut neu ist, wird
es jetzt an ein Erw erin̄ern, dieses wachrufen, mit
welchem es wenigstens theilweise zusam̄enfällt. An
diesem Erbild wiederholt sich nun der Denkvorgang
von vorhin nur gewißermaßen ohne das Ziel, welches
die besetzte Wunschvorstellg vorhin bot.S.
49
Soweit die Besetzgen übereinanderfallen, geben sie keinen
Anlaß zur Denkarbeit. Die auseinanderfallenden Anteile
dagegen „erwecken das Interesse" u können zu zweierlei Weisen
von Denkarbeit Anlaß geben. Entweder richtet sich der Strom
auf die geweckten Er u setzt eine ziellose Erinn̄erungsarbeit in
Gang, die also durch die Verschiedenheiten, nicht durch
die Ähnlichkeiten bewegt wird, oder er verbleibt in den neu
aufgetauchten Bestandtheilen u. stellt dan̄ eine ebenfalls
ziellose Urtheilsarbeit dar.Nehmen wir an, das Objekt, welches W liefert, sei dem
Subjekt ähnlich, ein Nebenmensch. Das theoretische Interesse
erklärt sich dan̄ auch dadurch, daß solches Objekt
gleichzeitig das erste Befriediggsobjekt, im ferneren das erste
feindliche Objekt ist, wie die einzige helfende Macht. Am
Nebenmenschen lernt darum der Mensch erken̄en. Dan̄ werden
die Wcomplexe, die von diesem N.menschen ausgehen, z. Th.
neu u unvergleichbar sein, seine Züge, etwa auf visuellem Gebiet,
andere visuelle W, z.B. die seiner Handbewegungen aber werden
im Subjekt über die Er eigener, ganz ähnlicher visueller
Eindrücke vom eigenen Körper fallen, mit denen die Er von
selbst erlebten Bewegungen in Association stehen. Noch andere
W des Objektes, z.B. wen̄ es schreit, werden die Erin̄erung an
eigenes Schreien u damit an¿eigene Schmerzerlebniße
wecken. Und so sondert sich der Complex des Nebenmenschen
in 2 Bestandteile, von denen der eine durch constantesS.
50
Gefüge imponiert, als Ding beisam̄enbleibt, während der
andere durch Erin̄erungsarbeit verstanden, dh auf eineei
Nachricht vom eigenen Körperzurückgeführt werden kann.
Diese Zerlegg eines Wcomplexes heißt ihn erkenen, enthält
ein Urtheil und findet mit dem letzt erreichten Ziel ein
Ende. Das Urtheil ist, wie man sieht, keine Primärf, sondern
setzt die Besetzg des disparaten Anteiles vom Ich aus
voraus; es hat zunächst keinen praktischen Zweck u es
scheint, daß beim Urtheilen die Besetzg der disparaten
Bestandtheile abgeführt wird, da sich so erklären würde,
warum sich die Thätigkeiten, „Prädikate" vom Subjektcomplex d
urch eine lockere Bahng sondern.Man kön̄te von hier aus tief in die Analyse des Urtheils-
aktes eingehen, allein dieß führt vom Thema ab.
Begnügen wir uns damit festzuhalten, daß es das ursprüngl
Interesse an der Herstellg der Befriediggssituation ist,
welches in einem Falle das reproducirende Nachdenken
im anderen Falle das Beurtheilen als Mittel erzeugt
hat, aus der real gegebenen W-situation auf die
gewünschte zu gelangen. Voraussetzg dabei bleibt,
daß die ψVorgänge nicht ungehem̄t, sondern bei
thätigem Ich ablaufen. Der eminent praktische Sinn aller
Denkarbeit wäre aber dabei erwiesen.S.
51
Denken u Realität.
Ziel u Ende aller Denkvorgänge ist also die Herbeiführg eines
Identitätszustandes, die Überführg einer von außen stam̄enden
Besetzg Qἠ in einevom Ich ausgegebenebesetztes Neuron.Das erken̄ende oder urtheilende Denken sucht eine Identität mit
einer Körperbesetzg, das reproducirende Denken mit einer eigenen
psych. Besetzg auf. Das urtheilende Denken arbeitet dem repro-
duzieenden vor, indem es ihm fertige Bahngen zur weiteren
Associationswanderg bietet. Kommt nach Abschluß des Denkaktes
das Real zur Wahrnehmg, so ist das Realitätsurtheil,
der Glaube gewon̄en u das Ziel der ganzen Arbeit erreicht.Für das Urtheilen ist noch zubemerken, daß dessen
Grundlage offenbar das Vorhandensein von eigenen Körper-
erfahrgen, Empfindgen und Beweggsbildern ist. Solange diese
fehlen, bleibt der variable Anteil des W-complexes unver-
standen, dh er kan̄ reproduzirt werden, giebt aber keine Richtg
für weitere Denkwege. So können z.B., was in der Folge
wichtig sein wird, alle sexuell Erfahrgen keine Wirkg äußern,
so lange das Individ keine Sexualempfindg kennt, dh
im Allgemeinen bis zum Beginn der Pubertät.Das primäre Urtheilen scheint eine geringere Beeinflußg
durch das besetzte Ich vorauszusetzen als die reproduzirenden
Denkakte. Handelt es sich dabei um Verfolgg einer Association
durch theilweises Übereinanderfallen, der keine ModificationS.
52
angethan wird. So kom̄en den̄ auch Fälle vor, in denen
der Urtheilsassociationsvorgang sich mit voller Quantität
vollzieht. W entspricht etwa einem Objektkern + einem Beweggs-
bild. Während man W wahrnim̄t, ahmt man die Bewegg
selbst nach, dh innervirt das eigene Beweggsbild, das auf
Aufeinanderfallen geweckt ist, so stark, daß die Bewegg
sich vollzieht. Man kan̄ daher von einem Imitationswerth
einer W sprechen. Oder die W weckt das Er einer
eigenen Schmerzempfindg, man verspürt dan̄ die entsprech.
Unlust u wiederholt die zugehörigen Abwehrbeweggen.
Dies ist der Mitleidswerth einer W.In diesen beiden Fällen haben wir wol den Primärvorgang
für das Urtheilen zu sehen u können annehmen, daß
alles sekund Urtheilen durch Ermäßigg dieser rein
associativen Vorgänge zu Standekgekom̄en ist. Das
Urtheilen, später ein Mittel zur Erken̄tniß des vielleicht
praktischenwichtigen Objektes, ist also ursprünglich ein
associativer Vorgang zwischen von außen kommenden u vom
eigenen Körper stam̄enden Besetzgen, eine Identificirg
von φ u Bin̄ennachrichten oder Besetzgen. Es ist vielleicht
nicht unrecht zu vermuthen, daß es gleichzeitig einen
Weg darstellt, wie von φ kom̄ende Q übergeführt
u abgeführt werden können. Was wir Dinge nen̄en,S.
53
sind Reste, die sich der Beurtheilung entziehen.
Aus dem Urtheilsbeispiel ergiebt sich zuerst ein Wink
für die Verschiedenheit im Quantit, welche zwischen Denken
u Primärvorgang zu statuiren ist. Es ist berechtigt anzunehmen,
daß beim Denken ein leiser Strom motorischer
Innervation von ψ abläuft, natürlich nur dan̄, wenn im
Verlauf ein motorisches oder SchlüßelN innervirt
worden ist. Doch wäre es unrecht, diese Abfuhr für den Denk-
vorgang selbst zu nehmen, von dem sie nur eine unbeabsichtigte
Nebenwirkg ist. Der Denkvorgang besteht in der Besetzg
von ψ N mit Abänderg des Bahnungszwanges durch Seiten-
besetzg vom Ich aus. Es ist mechanisch verständlich, daß dabei
nur ein Theil der Qἠ den Bahngen folgen kan̄ und daß
die Größe dieses Theils beständig durch die Besetzgen regulirt
wird. Es ist aber auch klar, daß damit gleichzeitig Qἠ genug
erspart wird, um die Reproduktion überhaupt nutzbringend
zu machen. Im anderen Falle würde alle Qἠ, die am Schluße
zur Abfuhr nötig ist, während des Umlaufes auf den
motorischen Auslaufpunkten verausgabt werden. Der
Sekundärvorgang ist also eine Wiederholg des urspr ψ Ablaufes
auf niedrigerem Niveau, mit geringeren Quantitäten.Noch kleinere Qἠ, wird man einwerfen, als sonst in ψN
verlaufen! Wie bringt man es zu Stande, so kleinen Qἠ
die Wege zu eröffnen, die doch nur für größereS.
54
als ψ in der Regel empfängt, gangbar sind? Die einzig
mögliche Antwort ist, dieß muß eine mechanische Folge
der Seitenbesetzgen sein. Wir müßen derartige Verhält-
niße erschließen, daß bei Seitenbesetzg kleine Qἠ durch
Bahngen abströmen, wo sonst nur große den Durchgang gefunden
hätten. Die Seitenbesetzg bindet gleichsam einen Betrag
der durch das N strömenden Qἠ.Das Denken muß ferner einer anderen Bedingg genügen. Es
darf die durch Primärvorgänge geschaffenen Bahngen nicht
wesentlich verändern, sonst fälscht es ja die Spuren der
Realität. Dieser Bedingg genügt die Bemerkg, daß Bahng
wahrscheinlich der Erfolg einmaliger großer Quantit ist
so daßu daß Besetzg, im Moment sehr mächtig, doch keinen
vergleichbar dauernden Effekt hinterläßt. Die kleinen
beim Denken passirenden Q kom̄en im Allgemeinen
gegen die Bahngen nicht auf.Es ist aber unzweifelhaft, daß der Denkvorgang doch dauernde
Spuren hinterläßt, da ein zweites Überdenken soviel
weniger Aufwand fordert als ein erstes. Um die Realität
nicht zu fälschen, bedarf es also besonderer Spuren, Anzeichen
für die Denkvorgänge, die ein Denkgedächtnißconstatiren
constituiren, welches sich bisher nicht formen läßt. Wir werden
später hören, durch welche Mittel die Spuren der
Denkvorgänge von denen der Realität geschieden werden.S.
55
Primärvorgänge – Schlaf u Traum.
Nun taucht die Frage auf, aus welchen quantitat Mitteln wird den̄
der ψ Primärvorgang bestritten? Beim Schmerzerlebniß ist es
offenbar die von außen einbrechende Q, beim Affekt
die durch Bahng entbundene endogene Qant; beim Sek.vorgang des
reproduz Denkens kan̄ offenbar auf das Nc eine größere
oder geringere Qἠ aus dem Ich übertragen werden, die
man als Denkinteresse bezeichnen darf, u die dem Affekt-
interesse proportional, wo ein solches entstehen konnte. Es
fragt sich nur, giebt es ψ Vorgänge primärer Natur, für
welche die aus φ mitgebrachte Qἠ hinreicht oder kom̄t
zur φ Besetzg einer W ein ψ Beitrag (Aufmerksamkeit)
automatisch hinzu, der erst einen ψ Vorgang ermöglicht?
Diese Frage bleibe offen, ob sie nicht etwa durch Spezial-
anpassg an psychol Thatsachen entschieden werden kann.Eine wichtige Thatsache ist es, daß wir ψ Primärvorgänge,
wie sie in der ψ Entwicklung biologisch allmählich unterdrückt
worden sind, alltäglich während des Schlafes vor uns haben.
Eine zweite Thatsache derselben Bedeutg, daß die patholog.
Mechanismen, welche die sorgfältigste Analyse bei den
Psychoneurosen aufdeckt, mit den Traumvorgängen die
größte Ähnlichkeit haben. Aus diesem später auszuführenden
Vergleich ergeben sich die wichtigsten Schlüße.S.
56
Zunächst ist die Thatsache des Schlafes in die Theorie einzutragen.
Die wesentliche Bedingg des Schlafes ist beim Kinde klar zu erken̄en.
Das Kind schläft, solange es kein Bedürfniß oder äußerer
Reiz quält (Hunger und Naßkälte). Es schläft mit der Befriedigg
(an der Brust) ein. Auch der Erwachsene schläft leicht post
coenam et coitum. Bedingg des Schlafes ist somit Absinken
der endogenen Ladung im ψ Kern, welche die Sekf überflüßig
macht. Im Schlaf ist das Individuum im Idealzustand der
Trägheit, des QἠVorrathes entledigt.Dieser Vorrath ist beim Erwachsenen im „Ich" angesam̄elt; wir
dürfen annehmen, daß es die Ichentladg ist, die den Schlaf
bedingt u characterisirt. Hiemit ist, wie sofort klar, die
Bedingg für psych Primärvorgänge gegeben.Ob das Ich sich beim Erwachsenen im Schlaf vollständig entlastet,
ist nicht sicher. Jedenfalls zieht es eine Unzahl seiner Besetzgen
ein, die aber mit dem Erwachen sofort u mühelos herge-
stellt werden. Dieß widerspricht keiner unserer Voraussetzgen,
macht aber aufmerksam darauf, daß zwischen gut
verbundenen N Strömungen anzunehmen sind, welche wie
in com̄unizirenden Gefäßen das gesamte Niveau betreffen,
obwol die Niveauhöhe im einzelnen N nur proportional
nicht gleichförmig zu sein braucht.Aus den Eigenthüml des Schlafes ist manches zu entnehmen,
was sich nicht errathen ließe:S.
57
Der Schlaf ist ausgez durch motorische (Willens)lähmung. Der Wille
ist die Abfuhr der gesamten ψ Qἠ: Im Schlaf ist der spinale
Tonus theilweise gelöst; es ist wahrscheinlich, daß die motorische
φ Abfuhr sich im Tonus äußert; andere Innervationen bestehen
mitsamt ihren Erreggsquellen.Es ist höchst interessant, daß der Schlafzustand beginnt und hervor-
zurufen ist mit Verschluß der verschließbaren Sinnesorgane.
W sollen im Schlaf nicht gemacht werden, nichts stört den Schlaf
mehr als Auftreten von Sinneseindrücken, Besetzg von φ her
in ψ. Dieß scheint darauf zu deuten, daß während des Tages
den Mantelneuronen, welche W von φ her empfangen, eine
beständige, wenngleich verschiebbare Besetzg entgegengeschickt
wird (Aufmerksamkeit), so daß sehr wol die ψ Primärvorgänge
sich mit diesem ψ Beitrag vollziehen können. Ob die MantelN
selbst bereits vorbesetzt sind oder anstoßende KernN, das
stehe dahin. Zieht ψ diese Mantelbesetzgen ein, so erfolgen
die W auf unbesetzte N, sind gering, vielleicht nicht im
Stande, von w aus ein Qualz zu geben. Wie wir vermuthet
haben, hört mit der Entleerg der wN dan̄ auch eine die Auf-
merks steigernde Abfuhrinnervation auf. Auch das Rätsel
des Hypnotisierens hätte hier anzusetzen. Auf dieser Einziehg
der Aufmerksamkeitsbesetzg wird die scheinbare Unerregbarkeit
der Sinnesorgane beruhen.Durch einen automatischen Mechanismus also, das Gegenstück
vom Aufmerksmechanismus, schließt ψ die φ Eindrücke aus,S.
58
solange es selbst unbesetzt ist.
Das Merkwürdigste aber ist, daß im T
raumSchlaf ψ Vorgänge ablaufen,
die Träume mit vielen unverstandenen Characteren.
Die Traumanalyse.
Die Träume zeigen alle Übergänge zum Wachen und Vermengg
mit normalen ψ Vorgängen, doch läßt sich das eigentlich
Traumhafte leicht herausklauben.1) Die Träume entbehren der motorischen Abfuhr, sowie zumeist
motorischer Elemente. Man ist im Traum gelähmt.Die bequemste Erklärg dieses Charakters ist der Wegfall der
spinalen Vorbesetzg durch Aufhören der φAbfuhr. Die motor.
Erregg kann die Pyschranke bei ungbesetztem N nicht überschreiten.
In sonstigen Traumzuständen ist Bewegg nicht ausgeschloßen.
Es ist nicht der wesentlichste Character des Traumes.2) Die Traumverknüpfgen sind theils widersinnig, theils schwach-
sinnig, oder auch sinnlos, seltsam toll.Der letztere Character erklärt sich daraus, daß im Traum der
Associationszwang herrscht, wie wol primär im psych Leben
überhaupt. Zwei gleichzeitig vorhandene Besetzgen müßen
scheint es in Verbindg gebracht werden. Ich habe komische
Beispiele für das Walten dieses Zwanges im Wachen
gesam̄elt (z. B. Zuhörer während des Attentates in der franz.
Kam̄er aus der Provinz, haben den Schluß gezogen, daß
nach jeder guten Rede eines Deputirten als BeifallszeichenS.
59
– geschossen wird.
Die beiden anderen, eigentlich identischen Charactere beweisen, daß
ein Theil der psych Erfahrgen vergessen ist. Thatsächlich sind ja
alle die biolog. Erfahrgen vergessen, die sonst den Primärvorgg
hem̄en u dieß wegen mangelnder Ichbesetzung. Wahrscheinlich
ist die Unsin̄igkeit und Unlogik des Traumes auf eben denselben
Character zurückzuführen. Es scheinen nicht eingezogene ψ Besetzgen
z. The nach ihren nächsten Bahngen, z. Th nach den benachbarten
Besetzgen sich abzugleichen. Bei vollständiger Ichentladg
müßte der Schlaf traumlos sein.3). Die Traumvorstellgen sind hallucinatorischer Art, erwecken
Bewußtsein u finden Glauben.Dies ist der bedeutsamste Schlafcharacter. Er tritt gleich beim
alternirenden Einschlafen auf, man schließt die Augen u hallucin,
öffnet sie u denkt in Worten. Es giebt mehrere Erklärungen
für die halluc Natur der Traumbesetzgen. Erstens könnte
man annehmen, die Strömg von φ zur Motilität habe eine
rückläufige Besetzg von ψ aus der φN gehindert; mit dem
Aufhören dieser Strömg werde φ rückläufig besetzt und
damit die Qualitbedingg gegeben. Dagegen spricht nur die Erwägg,
daß die φN durch Nichtbesetzg gegen Besetzg von ψ aus geschützt
sein sollten, ähnlich wie die Motilität. Es ist bezeichnend
für den Schlaf, daß er das ganze Verhältniß hier umkehrt,
die motorische Abfuhr von ψ aufhebt, die rückläufige nach φ
ermöglicht. Man könnte geneigt sein, den großen AbfuhrstromS.
60
des Wachens, φ-Motilität hier die entscheidende Rolle spielen
zu lassen. Man könnte zweitens auf die Natur des Primär
vorganges recurrieren, anführen, daß die primäre Er einer
W stets Hallucination ist u daß erst die Ichhem̄g gelehrt
hat, W nie so zu besetzen, daß es rückläufig auf φ übertragen
kann. Man könnte dabei zur Erleichterg der Annahme a
nführen, daß die Leitg φ-ψ jedenfalls leichter vor sich
geht als die ψ-φ, so daß selbst eine ψ Besetzg eines N,
welche die Wbesetzg desselben N weit überschreitet, doch noch
nicht rückläufig zu leiten braucht. Ferner spricht für diese
Erklärg der Umstand, daß im Traum die Lebhaftigkeit
der Halluci im geraden Verhältniß steht zur Bedeutg,
also zur quant Besetzg der betreff Vorstellg. Dieß weist
darauf hin, daß es die Q ist, welche die Hallucinat
bedingt. Kom̄t eine W von φ aus im Wachen, so wird sie
durch ψ Besetzg (Interesse) zwar deutlicher, aber nicht lebhafter,
sie ändert ihren quant. Character nicht.4). Der Zweck u Sinn der Träume (der normalen wenigstens
ist mit Sicherheit festzustellen. Sie sind Wunscherfüllungen
also Primärvorgänge nach den Befriediggserlebnißen
u werden nur darum nicht als solche erkannt, weil die
Lustentbindg (Reproduktion von Lustabfuhrspuren) bei ihnen
gering ist, weil sie überhpt. fast affektlos (ohne motorischeS.
61
Entbindg) verlaufen. Diese ihre Natur ist aber sehr leicht nachzuweisen.
Gerade daraus möchte ich schließen, daß die primäre Wunschbesetzg
auch halluc Natur war.3). Bemerkenswert ist das schlechte Gedächtniß und der geringe Schaden
der Träume im Vergleich mit anderen Primärvorgängen.
Das erklärt sich aber leicht dardaraus, daß die Träume meist nach
alten Bahngen gehen, also keine Veränderg machen, daß
die φErlebnisse von ihnen abgehalten sind u daß sie nichtdie
Abfuhrspuren hinterlassen wegen Motilitätslähmg.6) Interessant ist noch, daß das Bewußtsein im Traum so
ungestört die Qual wie im Wachen liefert. Dieß zeigt,
daß Bewußtsein nicht am Ich haftet, sondern Zuthat zu
allen ψ Vorgängen werden kann. Es warnt uns auch davor,
etwa die Primärvorgänge mit unbewußten zu identificiren;
zwei für die Folge unschätzbare Winke!Fragt man das Bewußtsein bei erhaltenem Traumgedächtniß
nach dem Trauminhalt aus, so ergibt sich, daß die Bedeutg
der Träume als Wunscherfüllgen verdeckt ist durch eine
Reihe von ψ Vorgängen, die sich alle bei den Neurosen
wiederfinden u deren krankhafte Natur characterisiren.S.
62
Das Traumbewußtsein.
Das Bewußts der Traumvorstellg ist vor allem ein discontin-
uirliches, es ist nicht ein ganzer Assocablauf bewußt worden,
sondern nur einzelne Stationen, dazwischen liegen unbewußte
Mittelglieder, welche man mit Leichtigkeit im Wachen auffindet.
Forscht man nach den Gründen dieses Überspringens, so
zeigt sich folgendes: Es sei A eine bewußt gewordene
Trvorst, sie führe zu B; anstatt B findet sich aber C
im Bewußts u zwar weil auf dem Wege zwischen B u
einer gleichzeitig vorhandenen Dbesetzg liegt.A / B / C / D
Es ergiebt sich also eine Ablenkg durch
eine gleichzeitige andersartige, selbst
übrigens nicht bewußte Besetzg.
Es hat sich also darum C dem B substituirt,
während B der Gedankenverbindg, der Wunsch-
erfüllung besser entspricht.Z. B.
R. hat der A. eine Injektion von Propyl gemacht,
dann sehe ich vor mir Trimethylamin sehr lebhaft, halluc als
Formel. Erklärg: Der gleichzeitig vorhandene Gedanke
ist die sexuelle Natur von A.’s Krankheit. Zwischen diesem
Gedanken u dem Propyl gibt es eine Association
in der Sexualchemie, die ich mit W. Fl. besprochen, wobei
er mir das Tr.meth.amin hervorgehoben. Dieß wird nun
bewußt durch beiderseitige Förderung.S.
63
Es ist sehr rätselhaft, daß nicht auch das Mittelglied (Sexualchemie
oder die ablenkende Vorstellg (sex Natur der Krankheit)
bewußt wird; u es bedarf einer Erklärg hiefür. Man
würde meinen, die Besetzg von B oder D sei allein nicht
intensiv genug, sich zur rückläufigen Halluc durchzusetzen
das gemeinsam besetzte C brächte dieß zu Stande. Allein
im gewählten Beispiel war D (Sexualnatur) gewiß so
intensiv wie A (Propylinjektion) und der Abköm̄ling
beider, die chemische Formel war enorm lebhaft.
Das Rätsel unbewußter Mittelglieder gilt ebenso für das
wache Denken, wo ähnliche Vorkom̄nisse alltäglich sind.
Characteristisch für den Traum bleibt aber die Leichtigkeit
der Verschiebg der Qἠ und somit die Ersetzung von B
durch ein quantit bevorzugtes C.Ähnlich bei der Wunscherfüllung im Traum überhpt. Es wird
nicht etwa der Wunsch bewußt u dann dessen Erfüllg
hallucinirt, sondern nur das letztere, das Mittelglied
bleibt zu erschließen. Es ist ganz gewiß passiert worden,
ohne sich qualitativ ausbilden zu können. Man sieht
aber ein, daß die Besetzg der Wunschvorstellg un-
möglich stärker sein kann als das dazu drängende
Motiv. Der psych Ablauf geschieht also im Traum nach
der Q; aber nicht die Q entscheidet über das Bewußt-
werden.S.
64
Es ist aus den Traumvorgängen etwa noch zu entnehmen,
daß das Bewußtsein während eines Qἠablaufes entsteht, dh
nicht durch eine constante1 Besetzg geweckt wird. Ferner
sollte man auf die Vermuthung geraten, daß eine intensive
Qἠströmung der Entstehg des Bewußtseins nicht günstig ist,
da sich dieß an den Erfolg der Bewegg, gewißermaßen
an ein ruhigeres Verweilen der Besetzg anschließt.
Es ist schwer zwischen diesen¿neinander widersprechenden
Bestim̄uen zur wirkl Bew. Bedingtheit durchzudringen.
Auch wird man dazu die Verhältnisse berücksichtigen
müssen, unter denen Bew im Sekvorgang entsteht.Vielleicht erklärt sich die vorhin angegebene Eigenthüm-
lichkeit des Traumbewußtseins daraus, daß ein Rückströmen
von Qἠ nach φ mit einer energischeren Strömung nach
ψ Associationsbahnen unverträglich ist. Für die φ Bewußts-
seinsvorgänge scheinen andere Bedinggen zu gelten.25. Sept 95.
S.
65
II Theil
Psychopathologie
Der I Theil dieses Entwurfes enthielt, was sich aus den Grund-
annahmen gewißermaßen a priori ableiten ließ, gemodelt u
corrigirt nach einzelnen thatsächl Erfahrgen. Dieser II Theil
sucht aus der Analyse patholog. Vorgänge fernere Bestim̄gen
des auf die Grundannahmen fundirten Systems zu errathen;
ein dritter soll aus beiden vorhergehenden die Charactere des
normalen psych Ablaufes aufbauen.A. Psychopathologie der Hysterie.
Der hysterische Zwang
Die Symptome (Sonderbarkeiten) der Hysterie.Ich beginne von Dingen, die sich bei der Hy. finden, ohne daß
sie ihr einzig eigen sein müßen. – Jedem Beobachter der Hy
fällt zunächst auf, daß die Hy einem Zwang unterliegen, der
von überstarken Vorstellgen ausgeübt wird. Es taucht
etwa eine Vorstellg besonders häufig im Bewußtsein auf,
ohne daß der Ablauf es rechtfertigen würde; oder es
ist die Erweckg dieser V. von psych. Folgen begleitet, die sich
nicht verstehen lassen. Mit dem Auftauchen der überstarken
Vorstellg sind Folgen verbunden, die einerseits nicht zu unter-
drücken, andererseits nicht zu verstehen sind, Affektentbindung,
motorische Innervationen, Verhinderungen. Dem Individuum
geht die Einsicht in das Auffällige des Sachverhaltes
keineswegs ab.Überstarke Vorstellungen gibt es auch normaler Weise. Sie
verleihen dem Ich seine Besonderheit. Wir wundernS.
66
uns nicht über sie, wen̄wir ihre genetische Entwicklg (Erziehg,
Erfahrungen) und ihre Motive kennen. Wir sind gewohnt in
solchen überstarken Vorst. das Ergebniß großer u berechtigter
Motive zu sehen. Die hysterischen üb.V. fallen uns dagegen
durch ihre Sonderbarkeit auf, es sind Vorst, die bei anderen
folgenlos sind u von deren Würdigkeit wir nichts verstehen.
Sie erscheinen uns als Emporköm̄linge, Usurpatoren,
daher als lächerlich.Der hysterische Zwang ist also 1) unverständlich, 2). durch
Denkarbeit unlöslich, 3). in seinem Gefüge incongruent.Es gibt einen einfachen neurotischen Zwang, den man mit
dem hysterischen in Contrast bringen darf, z. B. Ein Mann
ist aus einem Wagen gestürzt; dabei in Gefahr geraten
u kann seither nicht mehr in einem Wagen fahren. Dieser
Zwang ist 1) verständlich, denn wir ken̄en seine Herkunft, 3)
congruent, denn die Association mit Gefahr rechtfertigt
die Verknüpfg des Wagenfahrens mit Furcht. Er ist aber
auch durch Denkarbeit nicht löslich. Letzterer Charakter
ist nicht ganz pathologisch zu heißen, auch unsere normalen
überstarken Ideen sind oft unlöslich. Man würde den
neurotischen Zwang für gar nicht pathologisch halten, wenn die
Erfahrg nicht zeigte, daß ein solcher beim gesunden Menschen
nur kurz nach der Veranlassg fortbesteht, dan̄ mit der
Zeit zerfällt. Die Fortdauer des Zwanges ist also pathologisch
u weist auf eine einfache Neurose hin.S.
67
Nun ergeben unsere Analysen, daß der hyst. Zwang sofort
gelöst ist, wenn er aufgeklärt (verständlich gemacht ist).
Diese beiden Charactere sind also im Wesen eines.
Bei der Analyse erfährt man auch den Vorgang, durch
welchen der Anschein von Absurdität u Incongruenz zu-
stande gekom̄en ist. Das Resultat der Analyse ist allgemein
ausgedrückt folgendes:Vor der Analyse ist A eine überstarke Vorstellg, die sich zu
oft ins Bewußtsein drängt, jedesmal Weinen hervorruft. Das
Individuum weiß nicht, warum es bei A weint, findet es absurd
kann es aber nicht hindern.Nach der Analyse hat sich gefunden, daß es eine Vorstellg
B gibt, die mit Recht Weinen hervorruft, die mit Recht
sich oft wiederholt, so lange nicht eine gewiße komplicirte
psych. Leistg gegen sie vom Individ. vollbracht ist. Die Wirkg
von B ist nicht absurd, ist dem Individ verständlich, kann
selbst von ihm bekämpft werden.B steht zu A in einem bestim̄ten Verhältniß.
Es hat nämlich ein Erlebniß gegeben, welches aus B+ A
bestand. A war ein Nebenumstand, B war geeignet jene
bleibende Wirkg zu thun. Die Reproduktion dieses
Ereignißes in der Erin̄erg hat sich nun so gestaltet, als
ob A an die Stelle von B getreten wäre. A ist das
Substitut, das Symbol für B geworden. Daher die Incongruenz,
A ist von Folgen begleitet, deren es nicht würdig scheint, die
nicht zu ihm passen.S.
68
Symbolbildgen kom̄en auch normale Weise vor. Der Soldat
opfert sich für einen mehrfarbigen Fetzen auf einer Stange,
weil dieser zum Symbol des Vaterlandes geworden ist, u niemand
findet dies neurotisch.Das hysterische Symbol benim̄t sich aber anders. Der Ritter, der
sich für den Handschuh der Dame schlägt, weiß erstens, daß
der Handschuh seine Bedeutg der Dame verdankt, er ist
zweitens durch die Verehrg des Handschuhes in keiner Weise
gehindert, an die Dame zu denken u ihr sonst zu dienen.
Der Hyst., der bei A weint, weiß nichts davon, daß er dies
wegen der Association A-B thut und B selbst spielt in
seinem psych Leben gar keine Rolle. Das Symbol hat sich
hier dem Ding vollkom̄en substituiert.Diese Behauptung ist im strengsten Sinne richtig. Man überzeugt
daß bei allen Erweckgen von außen u aus der Association her,
die eigentlich B besetzen sollten, anstatt deßen A ins Bewußtsein
tritt. Ja, man kan̄ aus den Anlässen, die – merkwürdigerweise –
A erwecken, auf die Natur von B schließen.Man kann den Sachverhalt zusam̄enfassen, A ist zwangsartig,
B ist verdrängt (wenigstens aus dem Bewußtsein)Die Analyse hat das überraschende Resultat ergeben, daß
jedem Zwang eine Verdrängung entspricht, jedem übermäßigen
Eindrängen ins Bewußtsein eine Amnesie.Der Terminus "überstark" weißt auf quantit Charactere hin,
es liegt nähe anzunehmen, daß die Verdrängg den quantitS.
69
Sinn einer Entblösg von Q hat, u daß die Sum̄e von beiden
dem normalen gleich wäre. Dann hat sich nur die Verteilg
geändert, dem A ist etwas zugelegt worden, was dem B
entzogen wurde. Der pathol. Vorgang ist der einer Verschiebung,
wie wir sie im Traume kennengelernt haben, also
ein Primärvorgang.Die Entstehung des hysterischen Zwanges.
Nun entstehen mehrere inhaltsvolle Fragen: Unter welchen
Bedinggen kom̄t es zu einer solchen patholog. Symbolbildg,
(andererseits) Verdrängg? Welches ist die bewegende Kraft
dabei? In welchem Zustand befinden sich die N der überstarken
u die der verdrängten Vorstellg?Es wäre da nichts zu erraten u nicht weiter zu bauen, wenn
nicht die klinische Erfahrg zwei Thatsachen lehrte. Erstens
die Verdrängg betrifft durchwegs Vorstellgen, die dem Ich
einen peinlichen Affekt (Unlust) erwecken, zweitens Vorstellg
aus dem sexuellen Leben.Man kan̄ schon vermuthen, daß es jener Unlustaffekt
ist, welcher die Verdrängg durchsetzt. Wir haben ja
schon eine primäre Abwehr angenom̄en, die darin
besteht, daß die Denkströmung umkehrt, sobald sie
auf ein N stößt, dessen Besetzung Unlust entbindet.Die Berechtigg dazu ergab sich aus 2 Erfahrgen, 1) daß diese
Nbesetzung gewiß nicht die gesuchte ist, wo der Denkvorgang
ursprünglich die Herstellg der ψ Befriediggssituation bezweckte,
2). daß bei reflektorischer Beendigg eines SchmerzerlebnissesS.
70
die feindliche W durch eine andere ersetzt wurde.
Allein, man kann sich von der Rolle des Abwehraffektes
direkter überzeugen. Forscht man nach dem Zustand, in dem
sich die verdrängte B befindet, so entdeckt man, daß diese
leicht aufzufinden u ins Bewußtsein zu bringen ist. Dies
ist eine Überraschg, man hätte ja meinen kön̄en, B
sei wirklich vergeßen, keine Erinnerungsspur von B in ψ
geblieben. Nein B ist ein wie ein anderes, ist
nicht verlöscht, aber wenn, wie gewöhnlich, B ein Besetzgscomplex
ist, so erhebt sich ein ungemein großer, schwer zu besiegender
Widerstand gegen die Denkarbeit mit B. Man
darf ohne Weiteres in diesem Widerstand gegen B
das Maß des Zwanges sehen, den A ausübt, u darf
glauben, daß man die Kraft, welche seinerzeit
B verdrängt hat, hier neuerdings bei der Arbeit sieht.
Gleichzeitig erfährt man etwas Anderes. Man hat ja
nur gewußt, daß B nicht bewußt werden kann,
über das Verhalten von B zur Denkbesetzg war nichts
bekannt. Nun lernt man, daß der Widerstand sich
gegen jede Denkbeschäftigung mit B kehrt, wen̄ es auch
schon theilweise bewußtgemacht ist. Man darf also
anstatt vom Bewußtsein ausgeschlossen, einsetzen:
vom Denkvorgang ausgeschloßen.Es ist also ein vom besetzten Ich ausgehender Abwehr-
vorgang, der die hyst Verdrängg u damit den hyst
Zwang zur Folge hat. Insoferne scheint sichS.
71
der Vorgang von den ψ Primärvorgängen abzusondern.
Die pathologische Abwehr
Wir sind indeß weit entfernt von einer Lösung. Der
Erfolg der hy Verdrängg unterscheidet sich wie wir wissen
sehr weitgehend von demder primären Abwehr oderder
normalen Abwehr, von der wir genau Bescheid wissen.
Es ist ganz allgemein, daß wir es vermeiden an das zu
denken, was nur Unlust erweckt u wir thun dieß,
indem wir die Gedanken auf anderes richten. Allein
wenn wir dadurch erreichen, daß die unverträgliche B
selten in unserem Bewußts auftaucht, weil wir sie möglichst
isolirt erhalten haben, so gelingt es uns doch nie, an B
so zu vergessen, daß wir nicht durch neue Wahrnehmg
darin erin̄ert werden könnten. Nun kan̄ solche
Erweckg auch bei Hy nicht verhütet werden, der Unterschied
besteht nur darin, daß dan̄ anstatt B im̄er A bewußt
also besetzt wird. Es ist also die Symbolbildg so fester Ar
jene Leistg, welche über die normale Abwehr hinaus geht.Die nächste Erklärg dieser Mehrleistg wäre, daß die
größere Intensität des Abwehraffektes zu beschuldigen ist.
Allein die Erfahrung zeigt, daß die peinlichsten Erin̄erungen
welche notwendiger Weise die größte Unlust erwecken müssen
(Erinnerg von Reue über schlechte Thaten), nicht verdrängt u
durch Symbole ersetzt werden können. Die Existenz
der zweiten Bedingg für die pathol. Abwehr – die Sexual –
weist auch darauf hin, daß die Erklärg anderswo zu suchen
ist.S.
72
Es ist ganz unmöglich anzunehmen, daß peinliche sex. Affekte
an Intensität allen anderen Unlustaffekten so sehr
überlegen sein. Es muß ein anderer Character der
sex Vorstellg sein, welcher erklären kan̄, daß einzig
sex. Vorstellg der Verdrängung unterliegen.Noch eine Bemerkg ist hier anzufügen. Die hyst. Verdrängg
geschieht offenbar mit Hilfe der Symbolbildg, der
Verschiebg auf andere N. Man könnte nun meinen, das
Rätsel liege nur im Mechanism dieser Verschiebg,
an der Verdrängg selbst sei nichts zu erklären. Allein
wir werden bei der Analyse zB. der Zwangsn hören,
daß dort Verdrängg ohne Symbolbildg stattfindet, ja daß
Verdrängg u Substitution dort zeitlich auseinanderfallen.
Somit bleibt der Vorgang der Verdrängg als Kern
des Rätsels bestehen.Das hyst. proton pseudos.
Wir haben gehört, daß der hyst Zwang von einer
eigenthümlichen Art der Qἠbewegg (Symbolbildg) herrührt,
welche wahrscheinlich ein Primärvorgang ist, da er sich
im Traum leicht erweisen läßt; daß die bewegende
Kraft dieses Vorganges die Abwehr des Ich ist, welche
aber hier mehr leistet als normal. Wir brauchen
eine Erklärg dafür, daß bei eim Ichvorgang sich
Folgen einstellen, die wir nur bei PrimärvorggS.
73
gewohnt sind. Es sind da besondere psych. Bedingg zu erwarten.
Von klinischer Seite wissen wir, daß sich dies alles nur
auf sex Gebiet ereignet; vielleicht haben wir also die
bes. psych Bedingg aus natürl Characteren der Sexual
zu erklären.Nun gibt es auf sexuell Gebiet allerdings eine besondere
psych Constellation, die für unsere Absicht verwertbar
sein könnte. Wir wollen sie, die aus Erfahrg bekan̄t ist,
an einem Beispiel erörtern.Em̄a steht heute unter dem Zwange, daß sie nicht allein in
einen Kaufladen gehen kann. Zur Begründg desselben
eine Erin̄erung, als sie 12 J alt war (kurz nach Pubertät). Sie
ging in einen Laden etwas einkaufen, sah die beiden
Com̄is, von denen ihr einer in Erin̄erg ist, mit einander
lachen, u lief in irgend welchem Schreckaffekt davon. Dazu
lassen sich Gedanken erwecken, daß die beiden über ihr
Kleid gelacht und daß ihr einer sexuell gefallen habe.Sowohl die Beziehg dieser Theilstücke als auch die Wirkg des
Erlebnisses sind unverständlich. Wenn sie Unlust empfunden
hat, wegen ihres Kleides ausgelacht zu werden, so hätte
sich das längst corrigiren müßen, seitdem sie als Dame
gekleidet ist; auch ändert es nichts an ihrer Kleidg, ob sie
allein in den Laden geht oder begleitet. Daß sie nicht
direkte Schutz braucht, geht daraus hervor, daß - wie
bei Agoraphobie schon die Begleitg eines kleinen
Kindes ihr Sicherheit bringt. Ganz unvereinbar steht da
daß ihr der Eine gefallen hat; auch daran würdeS.
74
Begleitung nichts ändern. Die erweckten Er erklären also weder
den Zwang, noch die Determinierg des Symptoms.Weiteres Forschen deckt nun eine zweite Er auf, die im
Moment der Scene I gehabt zu haben, sie bestreitet.
Es ist auch durch nichts erwiesen. Als Kind von 8 J ging sie
2mal in den Laden eines Greißlers allein, um Naschereien
einzukaufen. Der Edle kniff sie dabei durch die Kleider
in die Genitalien. Trotz der ersten Erfahrg ging sie
ein zweites Mal hin. Nach dem zweiten blieb sie aus.
Sie macht sich nun Vorwürfe, daß sie zum zweiten Mal
hingegangen, als ob sie damit das Attentat provociren
hätte wollen. Thatsächlich ist ein Zustand des „drückenden
bösen Gewissens" auf dieß Erlebniß zurückzuführen.Wir verstehen nun Szene I (Com̄is) wen̄ wir Szene
II (Greißler) dazunehmen. Wir brauchen nur eine associat
Verbindung zwischen beiden. Sie giebt selbst an, diese
sei durch das Lachen gegeben. Das Lachen der Com̄is
habe sie an das Grinsen erin̄ert, mit dem der
Greißler sein Attentat begleitet. Nun läßt sich der
Vorgang wie folgt reconstruiren: Im Laden lachen
die beiden Com̄is, dies Lachen ruft (unbewußt)
die Erin̄erg an den Greißler wach. Die Situation hat
ja noch eine Ähnlichkeit, sie ist wieder im Laden allein.
Mit dem Greißler wird der Kniff durch die Kleider
erin̄ert, sie ist aber seitdem pubes geworden. DieS.
75
Erinnerg erweckt, was sie damals gewiß nicht konnte, eine
sexuelle Entbindg, die sich in Angst umsetzt. Mit dieser Angst
fürchtet sie, die Com̄is könnten das Attentat wieder-
holen u läuft davon.Es ist ganz sicher gestellt, daß hier 2 Arten von ψ Vorgängen
durch einandergehen, daß die Erin̄erg an Scene II (Greisler)
in einem anderen Zustand geschah als das Andere. Der
Hergang läßt sich folgendermaßen darstellen:Com̄is
lachen
Greisler
?????
Kleider
Kleider
Sexualentbindung
Alleisein
Laden
Flucht
Davon sind die geschwärzten V Wahrnehmgen, die auch erin̄ert werden
Daß die Sexualentbindg auch zum Bewußts kam, beweist die
sonst unverständliche Idee, der lachende Com̄is habe ihr gefallen.
Der Schluß, nicht allein im Laden zu bleiben wegen Attentats-
gefahr, ist ganz correkt gebildet, mit Rücksicht auf alle
Stücke des Associationsvorganges. Allein von dem (unten dargestellten)
Vorgang ist nichts zum Bewußts gekom̄en als das Stück Kleider
und das mit Bew arbeitende Denken hat aus dem
vorhandenen Material: (Com̄is, Lachen, Kleider, Sexualempfig)
zwei falsche Verknüpfungen gestaltet, daß sie wegen
ihrer Kleider ausgelacht worden, und daß der eine
Com̄is ihr sexuelles Gefallen erregt hat.Der ganze Complex (licht gehalten) ist im Bew vertreten durch
die eine Vorstellg Kleider, offenbar die harmloseste.S.
76
Es ist hier eine Verdrängung mit Symbolbildg vorgefallen. Daß
der Schluß – das Symptom – dan̄ ganz correkt gebildet ist, so
daß das Symbol keine Rolle darin spielt, ist eigentlich
eine Besonderheit des Falles.Man könnte sagen, daß eine Association durch unbewußte
Mittelglieder durchgeht, bis sie auf ein bewußtes kom̄t,
sei ganz gewöhnlich, wie es hier geschieht. Wahrscheinlich
tritt dan̄ jenes Glied ins Bewußts, welches ein besonderes
Interesse erweckt. In unserem Beispiel ist aber gerade
das bemerkenswerth, daß nicht jenes Glied ins Bew. tritt,
welches ein Interesse weckt (Attentat), sondern ein anderes
als Symbol (Kleider). Fragt man sich, was die Ursache
dieses eingeschobenen patholog Vorganges sein mag,
so ergibt sich nur eine einzige, die Sexualentbindg,
die auch im Bewußtsein bezeugt ist: Diese ist an die
Attentatserin̄erung geknüpft, allein es ist höchst bemerkens-
wert, daß sie an das Attentat, als es erlebt
wurde, nicht geknüpft war. Es liegt hier der Fall vor,
daß eine Erinnerg einen Affekt erweckt, den sie
als Erlebnis nicht erweckt hatte, weil unterdeß
die Veränderung der Pubertät ein anderes Verständniß
des Erin̄erten ermöglicht hat.Dieser Fall ist nun typisch für die Verdrängg bei der
Hysterie. Überall findet sich, daß eine Er verdrängt
wird, die nur nachträglich zum Trauma geworden ist.
Ursache dieses Sachverhaltes ist die Verspätg der Pubertät
gegen die sonstige Entwicklg des Individuums.S.
77
Bedingungen des πρω̃του ψεν̃δος ύστ.
77Obwohl es im psych Leben nicht gewöhnlich vorkom̄t, daß eine
Er einen Affekt erweckt, den sie als Erlebnis nicht
mitgebracht, so ist dies doch für die sexuell. Vorstellg etwas
ganz Gewöhnliches, gerade weil die Pubertätsverzögerg
ein allgemein Character der Organisation ist. Jede adolescente
Person hat Er.spuren, welche erst mit dem Auftreten von
sexuellen Eigenempfindgen verstanden werden können, jede
sollte also den Keim zur Hysterie in sich tragen. Es
bedürfte offenbar noch mitwirkender Momente, sollte
diese allgemeine Nötigg sich auf die geringe Anzal von
Personen einschränken, welche wirklich hyst. werden.
Nun weist die Analyse darauf hin, daß das Störende an
einem sex. Trauma offenbar die Affektentbindg ist,
u die Erfahrg lehrt die Hyst. als Personen kennen, von
denen z. Th. weiß, daß sie durch mech. u Gefühlsreizg vorzeitig
sex erregbar geworden sind (Masturb), z. TH. annehmen
kan̄, daß eine vorzeitige Sexentbindung in ihrer Anlage
liegt. Vorzeitiger Beginn der Sexual.entb. oder vorzeitig
stärkere Sexentb. ist aber offenbar gleichwertig. Dieß
Moment ist auf einen quantitativen Faktor reduziert.Worin soll nun aber die Bedeutg der Vorzeitigkeit
in der Sexualentbindg bestehen? Es fällt hier alles
Gewicht auf die Vorzeitigkeit, denn daß Sexualentbindg
überhpt zur Verdrängg Anlaß gibt, läßt sich nicht festhalten;
es würde die Verdrängg wiederum zu einem Vorgang
von normaler Häufigkeit machen.S.
78
Die Denkstörung durch den Affekt
Wir haben es nicht abweisen können, daß die Störg des
normalen psych Vorganges 2 Bedinggen hatte, 1) daß die
Sexualentbindg an eine Er statt an ein Erlebniß anknüpfte,
2). daß diese Sexualentbindg vorzeitig stattfand.
Durch diese beiden Zutaten sollte eine Störg verursacht
werden, welche das normale Maß überschreitet, die aber
auch im Normalen vorgebildet ist.Es ist eine ganz alltägliche Erfahrg, daß Affektentwicklung den
normalen Denkablauf hem̄t. u zw in verschiedener Weise.
Erstens, indem viele Denkwege vergessen werden, die sonst
in Betracht kämen, also ähnlich wie im Traum. So zB.
ist es mir vorgekom̄en, daß ich in der Erregg einer großen
Besorgnis vergessen habe, mich des seit kurzer Zeit bei
mir eingeführten Telephons zu bedienen. Die rezente Bahn
unterlag im Affektzustand. Die Bahnung, dh die Anciennität
gewan̄ die Oberhand. Mit diesem Vergeßen schwindet
die Auswal, die Zweckmäßigkeit u Logik des Ablaufes
ganz ähnlich wie im Traum. Zweitens, indem ohne Vergeßen
Wege beschritten werden, die sonst vermieden sind, insbes
Wege zur Abfuhr, Handlgen im Affekt. Schließlich nähert
sich der Affektvorgang dem ungehem̄ten Primärvorgang an.Hieraus ist mancherlei zu erschließen. Erstens daß bei
der Affektentbindg die entbindende Vorstellg selbst eine Verstärkg
gewinnt, zweitens daß die Hauptleistg des besetzten
Ich in der Verhütung neuer Affektvorgänge u der
Herabdrückg der alten Affektbahngen besteht. Man
kann sich das Verhältniß nur folgender Art vorstellen.S.
79
Ursprünglich hat eine Wbesetzg als Erbe eines Schmerzerlebnißes
Unlust entbunden, sich durch die entb. Qἠ verstärkt u ist nun
auf den z. Th. vorgebahnten Ablaufwegen zur Abfuhr vor-
gegangen. Auf bekannte Weise hat sich, nachdem ein besetztes
Ich gebildet war, die „Aufmerksamkeit" gegen neue W-
besetzgen entwickelt, die nun dem Ablauf von W aus mit
Seitenbesegen folgte. Dadurch ist die Unlustentbindung
quant eingeschränkt worden u deren Beginn war für
das Ich gerade ein Signal normale Abwehr vorzunehmen ,
so ist verhütet worden, daß neue Schmerzerlebnisse mit ihren
Bahngen so leicht entstehen. Je stärker doch die Unlust-
entbindg, desto schwieriger die Aufgabe für das Ich
das mit seinen Seitenbesetzgen doch nur den Qἠ bis
zu gewisser Grenze ein Gegengewicht bieten kann,
somit einen Primärablauf zulassen muß.Ferner, je größer die zum Ablauf strebende Quantität ist,
desto schwieriger ist für das Ich die Denkarbeit, welche
nach allen Andeutgen in einem probeweisn Verschieben
von kleinen Qἠ besteht. Das „Überlegen" ist eine zeiterford
Thätigkeit des Ich, die bei starken Qἠ, im Affektniveau
nicht statt haben kann. Daher die Voreiligkeit u die
Primärvorgang ähnliche Auswahl der Wege im Affekt.Es handelt sich also für das Ich darum keine Affektent-
bindg zuzulassen, weil es damit einen Primärvorgang
zuläßt. Sein bestes Werkzeug hiefür ist der Aufmerk-
samkeitsmechanismus. Könnte sich eine Unlust entbindende
Besetzg diesem entziehen, so käme das Ich dagegen zu spät.S.
80
Nun liegt beim hyst. p.ps. gerade dieser Fall vor. Die Aufmerks
ist auf W eingestellt, welche sonst zur Unl.entbind. Anlaß geben.
Hier ist keine W sondern eine Er, die unvermuteter
Weise Unlust entbindet, u das Ich erfährt davon erst zu
spät; es hat einen Primärvorgang zugelassen, weil es keinen erwartete.Allein, es kom̄t doch auch sonst vor, daß Er Unlust entbinden.
Gewiß, bei frischen Er ist dieß ganz normalerweise der Fall.
Zunächst wen̄ das Trauma (Schmerzerlebniß) kom̄t – die allersten
entgehen überhaupt dem Ich – zur Zeit, da es schon ein Ich giebt,
geschieht eine Unlustentbindg, aber gleichzeitig ist auch das Ich
thätig Seitenbesetzgen zu schaffen. Wiederholt sich die Erbesetzg,
so wiederholt sich auch die Unlust allein auch die Ichbahngen
sind schon vorhanden, die Erfahrg zeigt, daß zum zweiten
Mal die Entbindg geringer ausfällt, bis sie mit weiterer
Wiederholg auf die dem Ich genehme Intensität eines
Signals einschrumpft. Es handelt sich also nur darum,
daß bei der ersten Unlustentbindg die Ichhem̄g nicht
ausfällt, der Vorgang nicht als ein posthumes primäres
Affekterlebnis verläuft u gerade dieß wird erfüllt,
wenn wie im Fall des hyst p.ps. die Er zuerst die Unlust-
entbindg veranlaßt.Eine der angeführten von der klin. Erfahrg gelieferten
Bedinguen wäre hiemit in ihrer Bedeutg gewürdigt.
Die Pubertätsverspätung ermöglicht posthume Primär-
vorgänge.
OV 13 Box 39-15
Zur Quelle
Sigmund Freud
[Entwurf einer Psychologie]
1895
Das Original des Manuskripts befindet sich in der Library of Congress, Freud Collection.
Es ist den Sigmund Freud Archives zu danken, dass sich dieses Dokument in der Library of Congress findet.
Sigmund Freud. (1895) Sigmund Freud Papers: Oversize, -1985; Writings; 1950; "Entwurf einer Psychologie, 1895" Part of "Aus den Anfängen der Psychoanalyse," 1887 to 1902 a, holograph mansucript; Folder 1, pp. 1-80. - 1985. [Manuscript/Mixed Material] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/mss3999002094/.
Sigmund Freud. (1895) Sigmund Freud Papers: Oversize, -1985; Writings; 1950; "Entwurf einer Psychologie, 1895" Part of "Aus den Anfängen der Psychoanalyse," 1887 to 1902 a, holograph mansucript; Folder 1, pp. 1-80. - 1985. [Manuscript/Mixed Material] Retrieved from the Library of Congress, https://www.loc.gov/item/mss3999002094/.
Das Manuskript wurde im Auftrag der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung 2013 von Julian Roedelius, Juliane Grandegger, Nina Rike Springer abgelichtet.
Bearbeitung der Faksimile (2014): Christian Halwax, Eva Erhart
Dateneingabe (2014/15): Julian Roedelius, Eva Erhart
Diplomatische Umschrift (2019): Christine Diercks
Die Ablichtungen der Originale für die Edition erfolgte 2014 in der Library of Congress. Die automatisiert eingebenen Dateinamen der Faksimiles geben die Reihenfolge wieder, in der die Originale aufgefunden wurden. Die Seiten 38 und 41 wurden doppelt abgelichtet. Die Seiten 8 und 9 hingegen fehlten. Als Quelle für die Seiten 8 und 9 konnten die Digitalisate der LOC herangezogen werden, die 2017 veröffentlicht wurden.
Die ersten viereinhalb Seiten sind mit Bleistift geschrieben und im Telegrammstil (viele Abkürzungen, fehlende Worte und Satzzeichen) verfasst.
Die Buchstaben sind deutlich lesbar, aber das Schriftbild ist etwas verwackelt.
Die folgenden Seiten, geschrieben mit Füllfeder, sind ausformulierter, das Schriftbild ist klar.
Die Veröffentlichung versteht sich als ein erstes und in vielem noch vorläufiges Teilergebnis eines Gesamtvorhabens, das sich zum Ziele setzt, die strengen Kriterien einer textkritischen Edition zu erfüllen. Nach einem letzten Lektorat kann mit den Annotationen begonnen werden, abzuschließen werden diese erst in einem fortgeschritteneren Projektstadium sein.
Die historisch-kritische Edition des Manuskripts hat noch zu erfolgen.
Die Bibliografie findet sich bei der Edition des Werkes.
Für den Inhalt verantwortlich: Christine Diercks
Wien, 23. Juli 2019