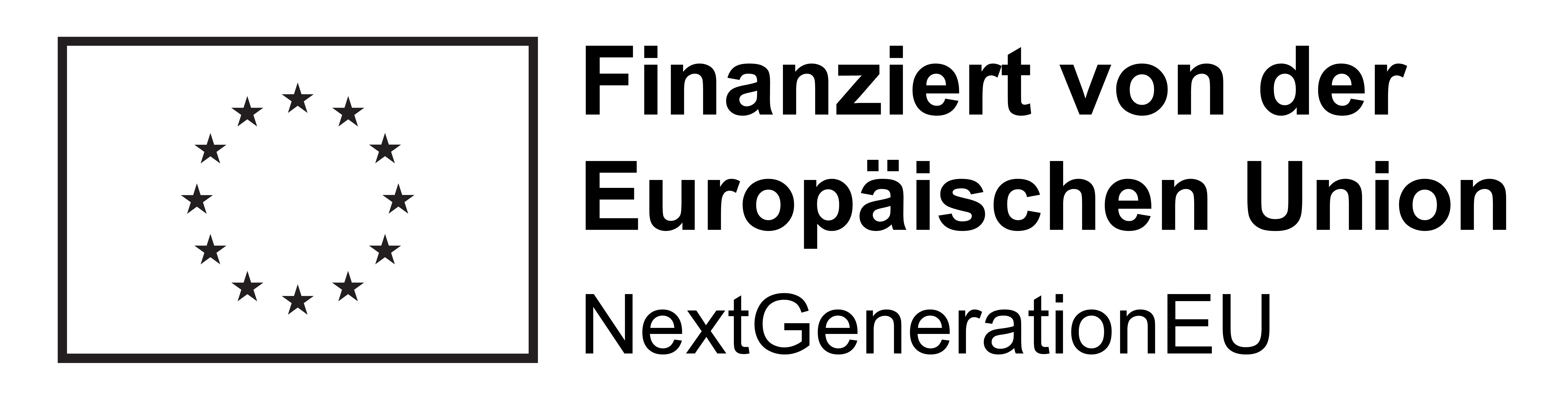S.
81
[III. Teil]
5. Okt 95. Versuch die normalen ψ Vorgänge darzustellen
Die sog Sekundärvorgänge müßen mechanisch zu erklären sein durch die
Wirkg, welche eine stetig besetzte Nmasse (das Ich) auf andere mit
wechselnden Besetzgen ausübt. Ich will zunächst die psychol. Darstellg
solcher Vorgänge versuchen.Habe ich einerseits das Ich, andererseits W (Wahrnehmgen), dh Besetzgen in
ψ von φ (der Außenwelt her), so bedarf ich eines Mechanismus, welcher
das Ich veranlaßt, den W zu folgen u sie zu beeinflußen. Ich finde ihn
darin, daß eine W nach meinen Voraussetzgen jedesmal ω erregt,
also Qualitätsz. abgibt. Genauer gesagt, sie erregt in ω Bewußtsein
(Bew. einer Qualität) u die Abfuhr der ω Erregg wird jede Abfuhr
eine Nachricht nach ψ liefern, welche eben das Qualitätz ist. Ich stelle
also die Vermutg auf, daß es diese Qualz sind, welche ψ für die W
interessiren.Es wäre dieß der Mechanismus der psych. Aufmerksamkeit. Seine Entstehg
mechanisch (automatisch) zu erklären fällt mir schwer. Ich glaube darum,
daß er biologisch bedingt ist, dh übriggeblieben im Laufe der psych
Entwicklg, weil jedes andere Verhalten von ψ durch Unlustentwicklg
ausgeschlossen worden ist. Der Effekt der psych Auf ist die Besetzg
derselben N, welche Träger der Wbesetzung sind. Dieser Zustand hat ein
Vorbild in dem für die ganze Entwicklg so wichtigen Befriediggserlebniß
u in dessen Wiederholungen, den Begierdezuständen, die sich zu Wunsch-
zuständen und Erwartgszuständen entwickelt haben. Ich habe dargelegt, daß
diese Zustände die biologische Rechtfertigg alles Denkens enthalten.Die psych. Situation ist dort folgende: Im Ich herrscht die Begierdespanng
in deren Folge die Vorstellg des geliebten Objektes (die Wunschvor-
stellg) besetzt wird. Biologische Erfahrg hat gelehrt, daß diese V nicht so
stark besetzt werden darf, um mit einer W verwechselt werden zu
können, u daß man die Abfuhr aufschieben muß, bis von V die
Qualz auftreten, als Beweis, daß V jetzt real, eine Wbesetzg ist.
Kommt eine W an, die mit V identisch oder ähnlich ist, so findet sie ihre
N durch den Wunsch vorbesetzt dh entweder schon alle besetzt oder
einen Theil davon, so weit eben die Übereinstim̄g geht. Die Differenz
zwischen der V und der ankommenden W giebt dan̄ den Anlaß zum
Denkvorgang, der sein Ende erreicht, wenn die überschüßigen
Wbesetzgen auf einem gefundenen Wege in V überführt
sind; dann ist Identität erreicht.Die Aufmerksamkeit besteht dann darin, die psych Situation des Erwartgs-
zustandes auch für solche W herzustellen, die nicht mit Wunschbesetzgen
teilweise zusam̄enfallen. Es ist eben von Wichtigkeit geworden,
allen W eine Besetzg entgegenzuschicken, da sich die gewünschten darunter
befinden könnten. Die Aufm ist biologisch gerechtfertigt; es handeltS.
[82]
sich nur darum, das Ich anzuleiten, welche Erwartgsbesetzg es herstellen
soll u dazu dienen die Qualz.Man kan̄ den Vorgang der psych Einstellg etwa noch genauer verfolgen.
Zunächst sei das Ich nicht vorbereitet. Es entstehe eine Wbesetzg u
darauf deren Qualz. Die innige Bahng zwischen beiden Nachrichten
wird die Wbesetzg noch steigern und nun wird die Aufmerksbesetzg
der WN erfolgen. Die nächste Wahrnehmg desselben Objektes wird
(nach demerstenzweiten Associationsgesetz) eine ausgiebigere Besetzg derselben
W zu Folge haben u erst diese wird die psychisch brauchbare W sein.
./. Schon aus diesem Stück der Darstellg ergiebt sich ein höchst bedeutsamer
Satz: Die Wbesetzg ist das erste mal eine wenig intensive, mit geringer
Q, das zweite mal bei ψ Vorbesetzg eine quantit größere.
Nun wird an dem Urtheil über die quantitativ Eigenschaften des Objektes
durch die Aufmerksamkeit principiell nichts geändert. Folglich kann
die äußere Q der Objekte sich in ψ nicht durch psych Qἠ ausdrücken
Die psych Qἠ bedeutet etwas ganz Anderes, in der Realität nicht
Vertretenes u die äußere Q drückt sich wirklich in ψ durch etwas
Anderes aus, durch Complexität der Besetzgen. Dadurch ist aber
die äußere Q von ψ abgehalten./.:Noch befriedigender ist folgende Darstellg: Es ist ein Resultat
biologischer Erfahrg, daß die ψ Aufmerks ständig den Qualz zuge-
wendet ist. Diese erfolgen also auf vorbesetzten N u mit genügend
großer Quantität. Die so verstärkten Qualnachrichten verstärken
durch ihre Bahng die Wbesetzgen u das Ich hat gelernt, seine
Aufmbesetzgen dem Verlauf dieser Associationsbewegg vom Qualz.
zu W folgen zu lassen. Es wird dadurch geleitet gerade die richtigen
W oder deren Umgebg zu besetzen. Ja wen̄ man annim̄t, daß es
dieselbe Qἠ aus dem Ich ist, welche auf der Bahng vom Qualz
zum W hin wandert, so hat man die Aufmerksbesetzg sogar
mechanisch (automatisch) erklärt. Die Auf verläßt also die
Qualz um sich den jetzt überbesetzten WN zuzuwenden.Nehmen wir an, aus irgendeinem Grund versagte der Aufm-
mechanismus, so wird die ψ Besetzg der WN ausbleiben und die
dorthin gelangte Q wird nach den besten Bahngen (rein associativ)
sich fortpflanzen, soweit es die Verhältniße zwischen Widerständen
u Quantität der Wbesetzg gestatten. Wahrscheinlich würde dieser
Ablauf bald sein Ende erreichen, da die Q sich theilt u alsbald
in einem nächsten N zu klein zur weiteren Strömg wird. Der
Ablauf der Wq kann unter gewißen Bedinggen nachträglich Aufm
erregen oder auch nicht. Dann endet er unbeachtet in Besetzg
irgend welcher NachN, deren Schicksal wir nicht kennen.S.
[83]
Dies ist ein W.ablauf ohne Aufmerks, wie er täglich ungezählte
Male vorkom̄en muß. Er kan̄ nicht weit reichen, wie die Analyse
des Aufmvorganges zeigen wird, u daraus kan̄ man auf Kleinheit
der Wz [oder: Wq] schließen.Wenn aber W seine Aufmerksbesetzg bekom̄en hat, kan̄ sich mancherlei
ereignen; worunter sich 2 Situationen herausheben lassen, die des
gemeinen Denkens u die des blos beobachtenden Denkens. Letzterer
Fall scheint der einfachere zu sein; er entspricht etwa dem Zustande
des Forschers, der eine W gemacht hat u sich fragt, was bedeutet das,
wohin führt das? Er geht dan̄ so vor: (ich muß aber der Einfachheit
halber jetzt der complexen Wbesetzg die eines einzelnen N substituiren):
Das WN ist überbesetzt, die aus Q und Qἠ zusam̄engesetzte Quantität
strömt ab nach den besten Bahnungen u wird je nach Widerstand u
Quantität einige Schranken überwinden u neue, associirte N besetzen
andere Schranken nicht überwinden, weil der auf sie entfallende
Quotient unter der Schwelle liegt. Es werden sicherlich jetzt mehr
u entfernter liegende N besetzt als beim bloßen Associatvorgang
ohne Aufm. Endlich wird auch hier der Strom in gewißen Endbesetzg
oder in einer einzigen enden. Der Erfolg der Aufm wird sein, daß
an Stelle der W mehrere oder eine (durch Assoc mit dem AusgangsN
verbundene) Erin̄ergsbesetzgen auftreten.Zur Einfachheit angenom̄en, es sei ein einziges Erbild. Könnte dieß
wieder von ψ aus (mit Aufm) besetzt werden, so würde sich das Spiel
wiederholen, die Q neuerdings in Fluß gerathen u auf dem Weg der
bestennächstenBahng ein neues Erbild besetzen (erwecken). Nun liegt es
offenbar in der Absicht des beobachtenden Denkens, die von W
aus führenden Wege möglichst weit ken̄en zu lernen; damit ist
ja die Kenntnis des Wobjektes erschöpfen. Wir merken, daß die hier
beschriebene Art des Denkens zum Erkennen führt. Darum braucht
es wieder eine ψ Besetzg für die erreichten Erbilder, aber auch einen
Mechanismus, der solche Besetzg an die richtigen Stellen leitet. Wie
sollen die ψ N im Ich sonst wissen, wohin die Besetzg zu leiten ist?
Ein Aufmmechanism wie der oben geschilderte setzt aber wieder
Qualc voraus. Entstehen diese während des Assoziationsablaufes?
Nach unseren Voraussetzgen sonst nicht. Sie können aber durch eine
neue Einrichtg gewonnen werden, die folgendermaßen aussieht:
Qualz kom̄en normaler Weise nur von W; also handelt es sich darum
aus dem Qἠablauf eine W zu gewinnen. Wen̄ an den Qἠablauf
eine Abfuhr geknüpft wäre (neben dem Rundlauf), so würde diese
wie jede Bewegg eine Beweggsnachricht liefern. Sind doch die
Qualz selbst nur Abfuhrnachrichten (vielleicht später, welcher Art.)S.
[84]
Nun kann es geschehen, daß während des Qablaufes auch ein motorisches
N besetzt wird, das dann Qἠ abführt und ein Qualz liefert. Allein
es handelt sich darum von allen Besetzgen solche Abfuhren zu erhalten.
Sie sind nicht alle motorisch, müßen also zu diesem Zweck mit
motorischen N in eine sichere Bahng gebracht werden.Diesen Zweck erfüllt die Sprachassociation. Sie besteht in der
Verknüpfg der ψ N mit N, welche den Klangvorstellgen dienen u
selbst die engste Association mit motorischen Sprachbildern haben.
Diese Associationen haben vor den anderen 2 Charaktere voraus,
sie sind geschloßen (wenig an Zahl) u ausschließlich. Vom Klangbild
gelangt die Erregg jedenfalls zum Wortbild, von diesem zur Abfuhr.
Sind also die Erbilder derart, daß ein Theilstrom von ihnen zu den Klangbildern
u motorischen Wortbildern gehen kann, so ist die Besetzg der Ersbilder
mit Abfuhrnachrichten begleitet, welche Qualz, damit auch Bewzeichen
der Er sind. Wen̄ nun das Ich diese Wortbilder vorbesetzt wie
früher die ω Abfuhrbilder, so hat es sich den Mechanism geschaffen,
der die ψ Besetzg auf die im Qἠablauf auftauchenden Erin̄erungen
lenkt. Dies ist bewußtes, beobachtendes DenkenDie Sprachassociation leistet außer der Ermöglichg des Erkennens noch
etwas anderes, sehr Wichtiges. Die Bahngen zwischen den ψ N sind wie
wir wissen, das „Gedächtniß”, die Darstellg aller Beeinflußgen, welche
ψ von der Außenwelt erfahren hat. Nun merken wir, daß das Ich
selbst gleichfalls Besetzgeninder ψ N vornimmt u Abläufe anregt, die
sicherlich auch Bahngen als Spuren hinterlassen müßen. ψ hat nun
kein Mittel, diese Folgen von Denkvorgängen von den Folgen
von Wvorgängen zu unterscheiden. Etwa die Wvorgänge sind durch
die Association mit ω Abfuhren zu erken̄en u zu reproduziren, von
den Bahngen aber, die das Denken gemacht hat, bleibt nur das
Resultat, nicht ein Gedächtniß. Dieselbe Denkbahng kan̄ durch einen
intensiven oder durch 10 minder eindringliche Vorgänge entstanden
sein. Diesem Mangel helfen nun die Sprachabfuhrzeichen ab,
sie stellen die Denkvorgänge den Wvorg gleich, verleihen ihnen
eine Realität und ermöglichen deren Gedächtniß.Die biologische Entwicklg dieser höchst wichtigen Association verdient auch
betrachtet zu werden. Die Sprachinnervation ist ursprünglich eine
ventilartig wirkende Abfuhrbahn für ψ, um QἠSchwankgen zu regeln,
ein Stück der Bahn zur inneren Veränderg, die die einzige Abfuhr
darstellt, so lange die spezifische Aktion erst zu finden ist.Diese Bahn gewinnt eine Sek.funktion, indem sie das hilfreiche
Individuum (gewöhnl das Wunschobjekt selbst) auf den begehrlichen
u nothleidenden Zustand des Kindes aufmerksam macht, u dient
von nun an der Verständigung, wird also in die specif.S.
[85]
Aktion miteinbezogen. Zu Beginn der Urtheilsleistung, wenn die W
wegen ihrer möglichen Beziehg zum Wunschobjekt interessiren usich
ihre Complexe (wie bereits geschildert) in einen unassimilirbaren
(das Ding) u einen dem Ich aus eigener Erfahrg bekannten (Eigen-
schaft, Tätigkeit) zerlegen, was man Verstehen heißt, ergeben sich
für die Sprachäußerg zwei Verknüpfungen. Erstens finden sich
Objekte – W – die einen schreien machen, weil sie Schmerz
erregen, u es stellt sich als ungeheuer bedeutsam heraus, daß
diese Association eines Klanges (der auch eigene )Bewegungsbilder anregt,
mit einer sonst zusam̄engesetzten W dies Objekt als ein feindliches
hervorhebt u dazu dient, die Aufmerks auf W zu lenken. Wo
man sonst vor Schmerz keine guten Qual des Objektes erhielt,
dient die eigene Schreinachricht zur Characteristik des Objektes.
Es ist also diese Association ein Mittel, die Unlust erregenden Erin̄ergen
bewußt u zum Gegenstand der Aufmerksamkeit zu machen, die
erste Klasse bewußter Erin̄ergen ist geschaffen. Es braucht nun nicht viel
um die Sprache zu erfinden. Es gibt andere Objekte, die constant
gewisse Laute von sich geben, in deren Wcomplex also ein Klang eine
Rolle spielt. Vermöge der beim Urtheilen auftretenden Imitations-
tendenz kan̄ man zu diesem Klangbild die Beweggsnachricht finden.
Auch diese Klasse von Er kan̄ nun bewußt werden. Nun erübrigt
noch, daß man willkürlich Klänge zu den W hinzu associirt, dan̄ werden
die Er beim Aufmerken auf die Klangabfuhrzeichen wie die W
bewußt u können von ψ aus besetzt werden.Wir haben also als characteristisch für den Vorgang des erken̄enden
Denkens herausgefunden, daß dabei von vorneherein die Aufmerks
den Denkabfuhrz, den Sprachz zugewendet ist. Wie bekannt, geht ja
auch das sog bewußte Denken mit leiser motorischer Verausgabung
vor sich.Der Vorgang der Verfolgg des Qablaufes durch eine Association kann
somit unbestim̄t lange fortgesetzt werden, gewöhnlich bis zu „völlig
bekannten” Associationsendgliedern. Die Fixirg dieses Weges und der
Endstationen enthält dann die „Erkenntniß” der etwa neuen W.Nun möchte man gerne etwas Quantit über diesen Erkenntniß-
Denkvorgang wissen. Die W ist ja hier im Vergleich zum naiven Assocvorgg
überbesetzt, der Vorgang selbst besteht in einer durch die Assoc mit Qualz
geregelten Verschiebg von Qἠ; bei jeder Station wird die ψ Besetzg
erneuert u endlich entsteht von den motor. N der Sprachbahn aus eine
Abfuhr. Man fragt sich nun, geht bei diesem Vorgang viel Qἠ dem Ich
verloren oder ist der Denkaufwand ein relativ geringer?Einen Fingerzeig für die Beantwortg gibt die Thatsache, daß die
beim Denken abfließenden Sprachinnervationen offenbar sehr
gering sind. Es wird nicht wirklich gesprochen, sowenig wie beim VorstellenS.
[86]
eines Beweggsbildes wirklich bewegt wird. Das Vorstellen u das
Bewegen sind aber nur quantitat verschieden, wie wir aus den
Versuchen über Gedankenlesen gelernt haben. Bei intensivem Denken
wird wol auch laut gesprochen. Wie kan̄ man aber so kleine Abfuhren
zu Stande bringen, da kleine Qἠ doch nicht strömen können u große
sich durch die motorischen N en masse abgleichen?Es ist wahrscheinlich, daß auch die Verschiebgsq nicht groß sind beim
Denkvorgang. Erstens ist der Aufwand großer Qἠ für das Ich ein
möglichst einzuschrankender Verlust, die Qἠ ist ja für die anspruchs-
volle specifische Aktion bestim̄t. Zweitens würde eine große Qἠ
gleichzeitig mehrere Associwege gehen u dem Denkbesetzen keine Zeit
lassen, auch großen Aufwand verursachen. Es sollen also wol kleine
Qἠ beim Denkvorgang strömen. Dennoch sollen nach unserer Annahme
die W u Er beim Denken überbesetzt sein, stärker als bei der
einfachen W. Ferner giebt es ja verschiedene Intensitäten von Auf-
merks, was wir nur übersetzen können, verschiedene Steigergen
der besetzenden Qἠ. Gerade mit stärkerer Aufmerks. wäre dann
das beobachtende Verfolgen schwieriger, was so unzweckmäßig ist,
daß man es nicht annehmen darf.Man hat zwei scheinbar entgegengesetzte Anfordergen: Starke Besetzg
u schwache Verschiebg. Will man die beiden vereinigen, so kom̄t man
zur Annahme eines gleichsam gebundenen Zustandes im N, der bei
hoher Besetzg doch nur eine geringe Strömg gestattet. Man kan̄ sich
diese Annahme plausibler machen, wen̄ man bedenkt, daß die
Strömg in einem N offenbar von den es umgebenden Besetzgen beein-
flußt wird. Nun ist das Ich selbst eine solche Masse von N, welche
ihre Besetzg festhalten, dh im gebundenen Zustand sind, u dies kan̄
wol nur durch Einwirkg untereinander geschehen. Man kan̄ sich
also vorstellen, ein W, das mit Aufmerks besetzt ist, wird dadurch
gleichsam in das Ich vorübergehend u unterliegt jetzt derselben
Qἠbindung wie alle Ich N. Wird es stärker besetzt, so kan̄ dadurch
die Strömgsqnichtverringert, nicht nothwendig vergrößert werden.
Man kan̄ sich etwa vorstellen, daß durch diese Bindg gerade die
externe Qverschzur Strömg frei bleibt, während die Aufmerks-
besetzg gebunden ist; ein Verhältniß, das natürlich nicht beständig
zu sein braucht.Durch diesen gebundenen Zustand, der hohe Besetzg mit geringer
Strömg vereint, würde sich also der Denkvorgang mechanisch
characterisiren. Es sind andere Vorgänge denkbar, in denen
die Strömg der Besetzg parallel läuft, Vorgänge mit unge
hem̄ter Abfuhr.S.
[87]
Ich hoffe, die Annahme eines solchen gebundenen Zustands wird
sich als mechanisch haltbar herausstellen. Ich möchte die psycholog Folgen
dieser Annahme beleuchten. Zunächst scheint die Annahme an einem
in̄eren Widerspruch zu leiden. Wen̄ der Zustand darin besteht, daß bei
hoher Besetzg nur kleine Q zur Verschiebg bleiben, wie kann er
neue N einbeziehen, dh große Q in neue N wandern lassen? Und dieselbe
Schwierigkeit zurückverlegt, wie hat sich überhaupt ein der Art zusam̄enge-
setztes Ich entwickeln können?So sind wir ganz unerwartet vor das dunkelste Problem gelangt, die
Entstehung des „Ich”, dh eines Complexes von N, die ihre Besetzg festhalten
also für kurze Zeiträume ein Complex constanten Niveaus. DieGgenetische
Behandlg wird die lehrreichste sein: Das Ich besteht ursprünglich aus den
Kern N, welche die endogene Qἠ durch Leitgen empfangen u auf dem Weg
zur in̄eren Veränderg abführen. Das Befriediggserlebniß hat diesem
Kern eine Assocciation verschafft mit einer W (dem Wunschbild) u
einer Bewegungsnachricht (des reflectorischen Antheils der spec. Aktion).
Im Wiederholgszustande der Begier, in der Erwartung findet die
Erziehg u Entwicklg dieses anfängl Ich statt. Es lernt zuerst, daß es
nicht die Beweggsbilder besetzen darf, so daß Abfuhr erfolgt, so
lange nicht gewiße Bedingg von Seite der W erfüllt sind. Ferner lernt
es, daß es die Wunschvorstellg nicht über ein gewisses Maß besetzen
darf, weil es sich sonst halluc täuschen würde. Wen̄ es aber diese beiden
Schranken respectiert und seine Aufmerks der neuen W zuwendet
hat es Aussicht die gesuchte Befriedigg zu erreichen. Es ist also klar, die
Schranken, welche das Ich hindern, Wunschbild u Beweggsbild über ein
gewißes Maß zu besetzen, sind der Grund einer Aufspeicherg von Qἠ
im Ich u nöthigen dieses etwa,sichseine bis zu gewißen Grenzen auf die
von ihm erreichbaren N zu übertragen.Die überbesetzten Kern N stoßen in letzter Linie an die durch continuirliche
Erfüllg mit Qἠ durchlässig gewordenen Leitungen aus dem In̄erende
an u müßen als deren Fortsetzg gleichfalls erfüllt bleiben. Die Qἠ in
ihnen wird nach Maßgabe der auf dem Wege befindlichen Widerstände
so weit abfließen, bis die nächsten Widerstände größer sind als der
zur Strömg disponible Qἠ quotient. Dan̄ aber ist die ganze Besetzgs-
masse im Gleichgewicht, einerseits gehalten durch die beiden Schranken
gegen Motilität und Wunsch, andererseits durch die Widerstände der
äußersten N u gegen das In̄ere durch den constanten Druck der
Leitung. Die Besetzg wird im In̄ern dieses Ichgefüges keineswegs
überall gleich sein, sie muß nur proportional gleich dh im Verhältniß
zu den Bahnungen.Wen̄ das Besetzgsniveau im Ichkern steigt, wird die Ichweite ihren Kreis
ausdehnen können, wen̄ sie sinkt, wird sich das Ich conzentrisch verengern.S.
[88]
Bei einem gewißen Niveau u Weite des Ich wird gegen eine Verschiebbarkeit
im Besetzungsgebiet nichts einzuwenden sein.Es fragt sich jetzt nur, wie stellen sich die beiden Schranken her, welche das
constante Niveau des Ich garantieren, besonders die gegen die Beweggs-
bilder, welche die Abfuhr hindert? Hier steht man einem entscheidenden
Punkt für die Auffassg der ganzen Organisation. Man kan̄ nur
sagen, als diese Schranke noch nicht bestand u mit dem Wunsch auch
die motorische Entladg eintrat, wurde regelmäßig die erwartete Lust
vermißt und die Fortdauer der endogenen Reizentbindg rief endlich
Unlust hervor. Nur diese Unlustdrohg, die sich an die vorzeitige
Abfuhr geknüpft hat, kann die in Rede stehende Schranke darstellen.
Im Laufe der Entwicklg hat dann die Bahng ein Theil der Aufgabe über-
nom̄en. Es steht aber noch fest, daß die Qἠ im Ich die Beweggsbilder
nicht ohne Weiteres besetzt, weil eine Unlustentbindg die Folge davon
wäre.Alles was ich einen biologischen Erwerb des Nsy heisse, denke ich mir
dargestellt durch eine solche Unlustdrohung, deren Wirkg darin
besteht, daß jene N nicht besetzt werden, welche zur Unlustentbindg führen.
Es ist die primäre Abwehr, eine verständliche Folge der ursprüngl
Tendenz des Nsy. Die Unlust bleibt das einzige Erziehungsmittel
Wie die primäre Abwehr, die Nichtbesetzg durch Unlustdrohg mechanisch
darstellbar ist, das weiß ich freilich nicht anzugeben.Ich gestatte mir von jetzt an, die mechanische Darstellung solcher biologischer
Regeln, die auf Unlustdrohg beruhen, schuldig zu bleiben; zufrieden,
wenn ich von da aus einer anschaulichen Entwicklg treu bleiben kann.
Eine zweite biologische Regel aus dem Erwartgsvorgang abstrahirt,
wird wol sein, die Aufmerkskeit auf die Qualz zu richten, weil
diese zu W gehören, die zur Befriedigg führen können u sich sodan̄
von dem Qualz zur aufgetauchten W leiten zu lassen. Kurz der Auf-
merks.mechanismus wird seine Entstehg einer solchen biolog. Regel
zu danken haben; er wird die Verschiebg der Ichbesetzgen regeln.Man kan̄ jetzt einwenden, daß ein solcher Mechanism mit
Hilfe der Qualz überflüssig ist. Das Ich könnte biologisch gelernt haben,
im Erwartgszustande das Wgebiet selbst zu besetzen, anstatt erst durch die
Qualz zu dieser Besetzg veranlaßt zu werden. Allein, hier ist zweierlei
zu sagen, um den Aufm. mech zu rechtfertigen 1) daß das Gebiet der
Abfuhrz von ω offenbar ein kleineres ist, weniger N umfaßt. als das der W
dh des ganzen mit den Sinnesorganen in Beziehg stehenden Mantels von
ψ ,so daß das Ich außerordentlich viel Aufwand spart, wenn es anstatt
W die Abfuhrz besetzt hält, u 2) daß die Abfuhrz oder Qualz zunächst
auch Realitätszeichen sind, welche gerade dazu dienen sollen, die realenS.
[89]
W besetzgen von den Wunschbesetzgen zu unterscheiden. Es ist also der Aufm mechanism.
nicht zu umgehen. Er besteht aber in jedem Falle darin, daß das Ich diejenigen
N besetzt, in denen eine Besetzg bereits aufgetreten ist.Die biologische Aufm Regel aber lautet für das Ich: Wen̄ ein Real auftritt,
so ist die gleichzeitig vorhandene Wbesetzg überzubesetzen.Es ist dies die zweite biolog Regel, die erste war die der primären Abwehr.
Aus dem Bisherigen lassen sich auch einige allgemeine Winke für die
mechanische Darstellg gewin̄en, wie jener erste war, daß die externe
Quantität nicht durch Qἠ, psych Quantit dargestellt sein kann. Aus der
Darstellg des Ich u dessen Schwankgen folgt nämlich daß auch die Niveauhöhe
keine Beziehg zur Außenwelt hat, daß allgemeine Erniedrigg oder Erhöhg
am Weltbild (normaler Weise) nichts ändert. Da das Außenweltbild auf
Bahnungen beruht, so heißt das, allgemeine Niveauschwankgen ändern an den
Bahnungen nichts. Ein zweites Princip ist schon erwähnt, daß bei hohem
Niveau kleine Quantit leichter verschiebbar sind als bei niedrigem.
Es sind dies einzelne Punkte, durch die die Characteristik der noch
ganz unbekan̄ten Nbewegg zu gehen hat.Kehren wir nun zur Beschreibg des beobachtenden oder erkennenden
Denkvorganges zurück, der sich vom Erwartungsvorgang dadurch unter-
scheidet, daß die W nicht auf Wunschbesetzgen fallen. Dann wird also das
Ich durch die ersten Realz aufmerks gemacht, welches W gebiet
zu besetzen ist. Der Associationsablauf der mitgebrachten Q vollzieht
sich über vorbesetzte N u das sich verschiebende Qφ wird jedesmal wieder
flott. Während dieses Ablaufes entstehen die Qualz (der Sprache), denen zu
Folge der Assocablauf bewußt u reproduziebar wird.Man könnte hier nun abermals die Ersprießlichkeit der Qualz in Frage
ziehen. Was sie leisten, sei ja doch nur das Ich zu veranlassen, daß sie dort
Besetzg hinschicken, wo im Ablauf eine Besetzg auftaucht. Sie bringen
diese besetzende Qἠ aber nicht selbst, sondern höchstens einen Beitrag
dazu. Dan̄ aber kan̄ das Ich ohne solche Unterstützg seine Besetzg
längs des Q Ablaufes wandern lassen.Das ist gewiß richtig, allein die Beachtg der Qualz ist doch nicht überflüßig.
Es ist nämlich hervorzuheben, daß die obige biol Regel der Aufmerks. aus
der Wahrnehmg abstrahirt ist u zunächst nur für Realz gilt. Die Sprachabfuhrz-
sind in gewißem Sinne auch Reals, der Denkrealität, aber nicht der
externen, u für sie hat sich eine solche Regel keineswegs durchgesetzt,
weil keine constante Unlustdrohg an deren Verletzg geknüpft wäre.Die Unlust durch Vernachlässigg der Erkenntniß ist nicht so eklatant wie
die bei Ignorirg der Außenwelt, obwol sie im Grund eines
sind. Es giebt also auch wirklich einen beobachtenden Denkvorgang
bei dem die Qualz nicht oder nur sporadisch erweckt werden, u der dadurchS.
90
ermöglicht wird, daß das Ich automatisch mit seinen Besetzgen dem
Ablaufe folgt. Dieser Denkvorgang ist sogar der bei weitem häufigere
ohne abnorm zu sein, es ist unser gemeines Denken, unbewußt mit
gelegentlichen Einfällen ins Bewußtsein, sog.bewußtes Denken mit
unbewußten Mittelgliedern, die aber bewußt gemacht werden können.Doch ist der Nutzen der Qualz für das Denken unbestreitbar.
Zunächst verstärken ja die erweckten Qualz die Besetzuen im Ablauf
u sichern die automatische Aufmerks, die offenbar an das Hervor-
treten von Besetzg – wir wissen nicht wie – geknüpft ist. Sodan̄, was
wichtiger erscheint, sichert die Aufm auf die Qualz die Unparteilichkeit
des Ablaufes. Es ist nämlich sehr schwer für das Ich, sich in die Situation
des bloßen Forschens zu versetzen. Das Ich hat fast im̄er Ziel- oder
Wunschbesetzgen, deren Bestand während des Forschens den Associatablauf
wie wir hören werden, beeinflußt, also eine falsche Kenntniß von
W ergibet. Es giebt nun keinen besseren Schutz gegen diese Denkfälschg
als wenn dem Ich eine sonst verschiebbare Qἠ auf eine Region
gerichtet wird, die eine solche Ablenkg des Ablaufes nicht äußern
kann. Solcher Auskünfte giebt es nur eine einzige, wen̄ nämlich die
Aufm sich den Qualz zuwendet, die keine Zielvorst sind, deren
Besetzg im Gegentheile den Assocablauf stärker hervorhebt durch
Beiträge zur Besetzgsquantität.Das Denken mit Besetzg der Denkrealz oder Sprachz ist also die
höchste, sicherste Form des erkennenden Denkvorganges.Bei der unzweifelhaften Nützlichkeit einer Erweckg der Denkz
darf man Einrichtgen erwarten, welche diese Erweckg sichern. Die
Denkz entstehen ja nicht wie die Realz spontan ohne Dazuthun von ψ.
Da sagt uns die Beobachtg, daß diese Einrichtgen nicht für alle Fälle von
Denkvorgang so gelten wie für den forschenden. Bedingg der Erweckg
der Dz überhaupt ist ja deren Aufm.besetzg; sie entstehen dan̄ nach dem
Gesetz, daß zwischen 2 verbundenen u gleichzeitig besetzten N die Leitung
begünstigt ist Doch hat die Lockg erzeugt durch die Vorbesetzg der
Dz nur eine gewiße Kraft u gegen andere Einflüße zu kämpfen.
So wird zB. jede außerdem in der Nähe des Ablaufes befindliche
Besetzg (Zielbesetzg, Affektbesetzg) koncurrieen u den Ablauf unbewußt
machen. Ebenso werden (was die Erfahrg bestätigt) größere Ablaufsq
wirken, die eine größere Strömung u damit Beschleunigg des ganzen
Ablaufes erzeugen. Die landläufige Behauptg „es habe sich etwas
so rasch in Einem vollzogen, daß man es nicht gemerkt habe", ist wol ganz
correct. Auch daß der Affekt die Erweckg der Dz stören kann,
ist allbekannt.S.
91
Für die mechanische Darstellg psych. Vorgänge ergiebt sich hieraus
ein neuer Satz, daß der Ablauf nämlich, der durch die Niveauhöhe
nicht verändert wird, durch die strömende Q selbst zu beeinflußen ist.
Eine große Q geht im allgemeinen andere Wege im Netz der Bahngen
als eine kleine. Es scheint mir nicht schwer dieß zu illustriren:Es giebt für jede Schranke einen Schwellenwert, unterhalb dessen die Q
überhaupt nicht passiert, geschweige den̄ ein Quotient von ihr; die so kleine Q
wird sich noch auf 2 andere Wege vertheilen für deren Bahng die Q ausr-
eicht. Steigt nun die Q, so wird der erste Weg in Betracht kom̄en
und seinen Quotienten fordern u. jetzt können auch Besetzgen etwa sich
geltend machen, die jenseits der nun überwindbaren Schranke liegen.
Ja, vielleicht kan̄ noch ein anderer Faktor zur Bedeutg kom̄en. Man
darf etwa annehmen, daß nicht alle Wege eines N gleich aufnahmsfähig
für die Q sind u diese Verschiedenheit als Wegbreite bezeichnen.
Die Wegbreite ist an sich unabhängig vom Widerstand, der ja durch Abq
zu verändern ist, während die Wegbreite constant bleibt. Nehmen wir nun
an, daß bei steigernder Q ein Weg eröffnet wird, der seine Breite
geltend machen kann, so sieht man die Möglichkeit ein, daß der
Ablauf der Q durch die Erhöhg der strömenden Q gründlich geändert
werde. Die Alltags Erfahrg scheint gerade diese Folgerung nach-
drücklich zu unterstützen.Die Erweckg der Denkz scheint nun an den Ablauf mit kleiner Q
geknüpft zu sein. Damit ist nicht behauptet, daß jeder andere Ablauf
auch unbewußt bleiben muß, den̄ die Erweckg der Sprachz istdernicht
der einzige Weg, Bewußts zu erwecken.Wie kan̄ man sich nun etwa das Denken mit unterbrochenem Bewußt-
werden, die plötzlichen Einfälle anschaulich darstellen? Unser gewöhn-
liches zielloses Denken, obwol unter Vorbesetzg u automatischer Aufmerks.
legt doch keinen Werth auf die Denkz. Es hat sich nicht biologisch ergeben,
daß diese für den Vorgg unentbehrlich sind. Siestehenpflegen aber doch
zu entstehen, 1) wenn der glatte Ablauf zu einem Ende gekom̄en oder
auf ein Hinderniß gestoßen hat, 2) wen̄ er eine Vorstellg erweckt hat,
die aus anderen Gründen Qualz, dh Bewußtsein wachruft. Hier
darf diese Erörterung abbrechen.–––
S.
92
Es gibt offenbar andere Arten des Denkvorganges, denen nicht das
uneigennützige Ziel des Erkennens, sondern ein anderes praktisches
vorschwebt. Der Erwartgszustand, von dem das Denken überhpt ausge-
gangen, ist ein Beispiel dieser zweiten Art des Denkens. Es wird hier
eine Wunschbesetzg festgehalten und daneben eine zweite auftauchende
Wbesetzg unter Aufmerksamkeit verfolgt. Es ist aber dabei nicht die
Absicht zu erfahren, wohin sie überhaupt führt, sondern auf welchen
Wegen sie zur Belebg der unterdeß festgehaltenen Wunschbesetzg
führt. Diese biologisch ursprünglichere Art des Denkvorganges läßt
sich leicht nach unseren Voraussetzgen darstellen. Sei V+ die Wunschvor-
stellg, die besonders besetzt gehalten wird, und W die zu verfolgende Wahr-
nehmung, so wird der Effekt der Aufmbesetzg von W zunächst sein, daß die
Qφ nach dem best gebahnten N a abläuft; von dort würde sie abermals
nach der besten Bahng gehen udgl. Diese Tendenz nach der besten Bahng
zu gehen, wird aber gestört werden durch das Vorhandensein von
Seitenbesetzungen. Wen̄ von a aus 3 Wege führen, ihrer Bahnung nach
geordnet nach b, c, d und d liege benachbart an die Wunschbesetzgw+V,
so kan̄ der Erfolg der sein, daß die Qφ trotz der Bahngen nicht
nach c u b sondern nach d strömt, von dort nach +V u somit den
Weg w-a-d-+V als den gesuchten enthüllt. Es wirkt hier das von
uns längst anerkannte Princip daß Besetzg die Bahng vertreten, ihr
also auch entgegenwirken kann, somit Seitenbesetzg den Qἠ ablauf
modificirt. Da die Besetzgen veränderlich sind, liegt es im Belieben
des Ich den Ablauf von W aus nach irgend welcher Zielbesetzg hin
zu modificiren.Unter Zielbesetzg ist hierbei keine gleichmäßige verstanden, wie sie bei
der Aufm ein ganzes Gebiet trifft, sondern eine hervorhebende,
über das Ichniveau hervorragende. Wahrscheinlich muß man die Annahme
machen, daß bei diesem Denken mit Zielbesetzgen gleichzeitig auch
Qἠ von +V aus wandert, so daß der Ablauf von W nicht nur von +V,
sondern auch von dessen weiteren Stationen beeinflußt werden kann.
Nur ist dabei der Weg +V …. bekannt u fixirt, der Weg von W … a …
zu suchen. Da unser Ich eigentlich im̄er Zielbesetzgen, oft gleichzeitig
in mehrfacher Zahl unterhält, versteht sich nun sowol die Schwierig-
keit eines rein erken̄enden Denkens als auch die Möglichkeit
bei dem praktischen Denken auf die allerverschiedensten
Wege zu gelangen, zu verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen
Bedinggen u für verschiedene Personen.S.
93
Beim praktischen Denken kann man auch eine Würdigung der Denkschwierig-
keiten bekom̄en, die man ja aus eigener Empfindg kennt. Um das
frühere Beispiel aufzunehmen, daß der Qφ-Strom der Bahng nach
nach b u c abfließen würde, während d durch die nahe Verbindg mit
der Zielbesetzung oder ihrer Folgevorst. ausgezeichnet ist, so kann der
Einfluß derBahngzu Gunsten von b c so groß sein, daß er die Anziehg
d … +V weit überwiegt. Um doch den Ablauf nach +V zu lenken,
müßte die Besetzung von +V u seinen Ausläufervorst. noch mehr gesteigert
werden, vielleicht auch die Aufm auf W verändert, damit eine größere
oder geringere Bindg u ein Strömungsniveau erreicht wird, welches
dem Weg d …+V günstiger ist. Solcher Aufwand zur Überwindg
guter Bahngen, um die Q auf schlechter gebahnte, der Zielbesetzg aber
näher gelegene Wege zu lokken, entspricht der Denkschwierigkeit.Die Rolle der Qualz beim praktischen Denken wird sich von der
beim erken̄enden wenig unterscheiden. Die Qualz sichern u fixiren
den Ablauf, sind aber nicht unumgänglich für ihn erforderlich.
Wen̄ man anstatt der N Complexe u anstatt der Vorst-Complexe setzt,
stößt man auf eine nicht mehr darstellbare Complexität des praktischen Denkens
u begreift, daß rasche Erledigg hier wünschenswert wird. Während eines
solchen werden aber die Qualz meist nicht vollständig erweckt, u deren
Erweckg dient ja dazu, den Ablauf zu verlangsamen u zu compliziren.
Wo der Ablauf von einer gewißen W nach gewißen bestim̄ten Zielbesetzgen
bereits wiederholt geschehen u durch Gedächtnißbahngen stereotypirt ist,
wird zur Erweckg der Qualz meist kein Anlaß sein.Das Ziel des praktischen Denkens ist die Identität, die Einmündung
der verschobenen Qφbesetzg in die unterdeß festgehaltene Wunschbesetzg.
Es ist rein biologisch zu nehmen, daß damit die Denknötigung aufhört
u dafür die Vollinnervation der auf dem Weg berührten Beweggsbilder
gestattet ist, die ein unter den Umständen berechtigtes accessorisches Stück
der specif. Aktion darstellen. Da während des Ablaufes dieses Beweggs-
bild nur in gebundener Weise besetzt worden u da der Denkproceß
von einem W ausgegangen ist, das dan̄ nur als Erbild verfolgt wurde, so
kan̄ sich der ganze Denkproceß von dem Erwartgsvorgang u der Realität
unabhängig machen u in ganz unveränderter Weise bis zur Identität
fortschreiten. Er geht dan̄ von einer bloßen Vorst aus, u führt auch
nach seiner Vollendg nicht zur Handlg., hat aber ein praktisches Wissen
das vorkom̄enden realen Falles verwertbar ist, ergeben. Es erweist
sich eben als zweckmäßig den praktischen Denkvorgg nicht erst
anstellen zu müßen, wen̄ man ihn angesichts der Realität bedarf,
sondern ihn dafür vorbereitet zu halten.S.
94
Es ist nun an der Zeit, eine vorhin gemachte Aufstellg einzuschränken, nämlich
daß ein Gedächtniß der Denkvorgänge nur durch die Qualz ermöglicht
sei, weil deren Spuren sich sonst von den Spuren der Wbahngen nicht unter-
scheiden ließen. Daran ist festzuhalten, daß das Realgedächtniß correcter
Weise durch alles Denken darüber nicht modificirt werden darf.
Andererseits ist unleugbar, daß das Denken über ein Thema für ein
nächstes Überdenken außerordentlich bedeuts Spuren hinterläßt
u es ist sehr fraglich, ob nur das Denken mit Qualz u Bewußts
dieß thut. Es muß also Denkbahngen geben u doch dürfen die
urspr Associationsbahnen nicht verwischt werden. Da es nur einerlei
Bahngen geben kann, sollte man meinen, die beiden Folgergen sind
unvereinbar. Doch muß eine Vereinigg und Erklärg in dem Umstande
zu finden sein, daß die Denkbahngen alle erst bei hohem Niveau
geschaffen worden sind, sich wahrscheinlich auch wieder bei hohem
Niveau geltend machen, während die Assocbahngen in Voll- oder
Primärabläufen entstanden wieder hervortreten, wen̄ die Bedinggen
des ungeb Ablaufes hergestellt sind. Damit soll nun nicht jede mögliche
Einwirkg der Denkbahngen auf die Assocbahngen geleugnet werden.Wir gewin̄en für die unbekan̄te Nbewegg also noch
folgende Characteristik:Das Gedächtniß besteht in den Bahngen. Die Bahngen werden durch
Niveauhebg nicht verändert, es gibt aber Bahngen, die nur für
ein bestim̄tes Niveau gelten. Die Richtg des Ablaufes wird durch
Niveauänderg zunächst nicht geändert, wol aber durch die Strömgsquantit
u durch Seitenbesetzgen. Bei großem Niveau sind eher kleine Q
verschiebbar.Neben dem erken̄enden u dem praktischen Denken muß ein reproduz-
irendes, erin̄erndes Denken unterschieden werden, das z. Th. ins praktische
eingeht, es aber nicht erschöpft. Dieses Erin̄ern ist die Vorbedingg jeder
Prüfg des kritischen Denkens; es verfolgt einen gegebenen Denk-
vorgang in umgekehrter Richtung, etwa bis auf eine W zurück, wieder
unter Ziellosigkeit, zum Unterschiede vom praktischen Denken u
bedient sich dabei im großen Umfange der Qualz. Bei dieser
Rückverfolgg stößt der Vorgang auf Mittelglieder, die bis dahin
unbewußt waren, kein Qualz hinterlassen haben, deren Qualz
sich aber nachträglich ergeben. Es folgt hieraus, daß der Denkablauf
an und für sich ohne Qualz Spuren hinterlassen hat. In manchen
Fällen hat es hier freilich den Anschein, als ob man gewiße Weg-
strecken nur errathen würde, weil deren Ausgangsund Endpunkt
durch Qualz gegeben ist.S.
95
Die Reproduzirbarkeit der Denkvorgänge geht jedenfalls weit über
ihre Qualz hinaus; sie sind nachträglich bewußt zu machen, wen̄ vielleicht
auch öfter das Resultat des Denkablaufes als dessen Stadien
Spuren zurückgelassen hat.Im Denkablauf können allerlei Ereigni0e vorfallen, welche eine
Darstellg verdienen, sei es nun erken̄endes, prüfendes oder
praktisches Denken. Das Denken kan̄ zur Unlust führen oder zum
Widerspruch. Wir folgen dem Falle, daß praktisches Denken mit
Zielbesetzgen zur Unlustentbindg führe.Die gemeinste Erfahrg zeigt, daß dieses Ereigniß ein Hinderniß für
den Denkfortgang ergiebt. Wie kan̄ es überhaupt zu Stande kom̄en?
Wenn eine Erin̄erg bei ihrer Besetzg Unlust entwickelt, so hat dieß ganz
allgemein seinen Grund darin, daß die entsprechende W seinerzeit
Unlust entwickelt hatte, also einem Schmerzerlebniß angehört. Solche
W ziehen erfahrgsgemäß hohe Aufmerksamkeit auf sich, erregen
aber weniger ihre eigenen Qualz als die der Reaktion zu welcher
sie Anlaß geben; sie associiren sich mit den eigenen Affekt- u
Abwehräußerungen. Verfolgt man das Schicksal solcher W als Erbilder,
so bemerkt man, daß die ersten Wiederholungen im̄er noch
sowol Affekt als auch Unlust erwecken, bis mit der Zeit solche
Fähigkeit ihnen verlorengeht. Gleichzeitig vollzieht sich mit ihnen
eine andere Veränderung. Sie haben anfänglich den Character
der sinnlichen Qualitäten festgehalten; wen̄ sie nicht mehr affektfähig
sind, verlieren sie auch diesen u werden anderen Erbildern gleich.
Stößt der Denkablauf auf einesolches noch ungebändigtes Erbild
so entstehen dessen Qualz, oft sinnlicher Art, Unlustempfindg und Abfuhr-
neiggen, deren Combination einen bestim̄ten Affekt auszeichnet
u der Denkablauf ist unterbrochen.Was geht wol mit den affektfähigen Er vor, bis sie gebändigt werden?
Es ist nicht einzusehen, daß die „Zeit", die Wiederholg ihre Affektfähigkeit
abschwächt, da dieß Moment sonst gerade zur Verstärkg einer
Association beiträgt. Es muß wol in der „Zeit", bei den Wiederholgen
etwas vor sich gehen, was diese Unterwerfg besorgt, u dieß kan̄
nichts anderes sein, als daß eine Beziehg zum Ich oder zu Ichbesetzgen
Macht über die Er bekom̄t. Wen̄ dies hier länger braucht als
sonst, so ist ein besonderer Grund hiefür zu finden uzw in der Her-
kunft dieser affektfähigen Er. Als Spuren von Schmerzerlebnißen
sind sie (nach unserer Annahme über den Schmerz) von übergroßen
Qφ besetzt gewesen u haben eine überstarke Bahng zur Unlust- u
Affektentbindg erworben. Es braucht besonders große u wiederholte
Bindg vom Ich aus, bis dieser Bahng zur Unlust die Waage gehalten
wird.S.
[96]
Daß die Er so lange Zeit halluc Character zeigt, fordert auch seine, —
für die Auffassg der Hallucination überhaupt bedeutsame — Erklärg.
Es liegt hier nahe anzunehmen, daß diese Hallucfähigkeit wie die
Affektfähigkeit Anzeichen dafür sind, daß die Ichbesetzg noch keinen
Einfluß auf die Er gewon̄en hat, daß in dieser die primären Abfluß-
richtungen und der Voll- oder Primärvorgang überwiegen.Wir sind genöhtigt, im Halluc.werden ein Rückströmen der Q nach φ
u damit nach ω zu sehen, ein gebundenes N läßt solche Rückströmg
also nicht zu. Es fragt sich noch, ob es die übergroße Besetzgsquantität
der Er ist, welche das Rückströmen ermöglicht. Allein hier muß man
sich erinnern, daß eine solche große Q nur das erste Mal, beim
wirklichen Schmerzerlebniß da ist. Bei der Wiederholg haben wir es
nur mit einer gewöhnlich starken Besetzg von Erzu thun, die
den̄och Halluc und Unlust durchsetzt; wir können nur annehmen
kraft einer ungewöhnl starken Bahnung. Daraus folgt, daß
die gemeine φ Quantität wol zur Rückströmg u zur Abfuhrerregg
ausreicht u die hem̄ende Wirkg der Ichbindg gewinnt an Bedeutung.Es wird nun endlich gelingen die Schmerz Er so zu besetzen, daß sie
keine Rückströmg äußern und nur minimale Unlust entbinden
kan̄, sie ist dan̄ gebändigt. uz durch eine so starke Denkbahng
daß diese bleibende Wirkg äußert u bei jeder späteren
Wiederholg von Er abermals hem̄end wirkt. Es wird dan̄ durch
Nichtgebrauch der Weg zur Unlustentbindg allmalich seinen
Widerstand vergrößern. Bahngen sind ja dem allmalichen
Verfall (Vergessen) unterworfen. Erst dann ist Er eine
gebändigte Erinnerung wie eine andere.Indeß scheint es, daß dieser Unterwerfgsvorgang der Er
eine bleibende Folge für den Denkablauf hinterläßt.
Da früher jedesmal mit Belebg der Er u Erweckg von Unlust
der Denkablauf gestört wurde, ergiebt sich eine Tendenz, auch
jetzt den Denkablauf zu hem̄en, sobald die gebändigte Er ihre
Spur von Unlust entwickelt. Diese Tendenz ist für das
praktische Denken sehr gut brauchbar, denn ein Mittelglied,
das zur Unlust führt, kan̄ nicht auf dem gesuchten Weg
zur Identität mit der Wunschbesetzg liegen. Es entsteht also
die primäre Denkabwehr, welche im praktischen Denken
die Unlustentbindung zum Signal nim̄t, einen gewißen
Weg zu verlassen, dh die Aufmerksabesetzung andershin zu
richten. Wieder lenkt hier die Unlust den Strom der Qἠ
wie in der ersten biologischen Regel. Man könnte fragen,
warum diese Denkabwehr sich nicht gegen die noch affektfähige
Er gerichtet hat. Allein dort, dürfen wir annehmen, hat sichS.
[97]
die zweite biolog Regel dagegen erhoben, welche Aufmerksamkt verlangte, wo
ein Realz vorliegt u die ungebändigte Er war noch im Stande reale
Qualz zu erzwingen. Man sieht beide Regeln vertragen sich als
zweckmäßig.Es ist interessant zu sehen, wie das praktische Denken sich durch die biolog-
ische Abwehrregel lenken läßt. Im theoret (erken̄enden prüfenden)
wird die Regel nicht mehr beobachtet. Begreiflich, da es sich beim
Zieldenken um irgend einen Weg handelt u dabei die mit Unlust
behafteten ausgeschieden werden können, während beim theoretischen
alle Wege erkan̄t werden sollen.Des Weiteren erhebt sich die Frage, wie kann auf dem Denkwege Irrthum
entstehen? Was ist Irrthum?Der Denkvorgang muß nun noch genauer erwogen werden. Das praktische
Denkender Ursprung, bleibt auch das Endziel aller Denkvorgänge.
Alle anderen Arten sind von ihm abgespalten. Es ist ein offenkundiger
Vortheil, wenn die Denküberführg, die im praktischen Denken vorkom̄t,
nicht erst im Erwartgszustand vor sich geht, sondern schon geschehen
ist weil 1)hiedurch Zeit für die Gestaltg der spec. Aktion erspart
wird, 2) der Erwartgszustand dem Denkablauf gar nicht bes. günstig ist.
Der Werth der Promptheit des kurzen Intervalles zwischen W u Handlg
ergiebt sich aus der Erwägg, daß die W rasch wechseln. Hat der Denkvorgg
zu lange angehalten, so ist sein Ergebniß unterdeß unbrauchbar worden.
Es wird daher „vorbedacht“.Anfang der abgespaltenen Denkvorgänge ist die Urtheilsbildg, auf welche
das Ich durch einen Fund in seiner Organisation gelangt, durch
das schon angeführte teilweise Zusam̄enfallen der Wbesetzgen mit
Nachrichten vom eigenen Körper. Dadurch sondern sich die Wcomplexe
in einen constanten, unverstandenen Theil, das Ding, u einen
wechselnden, verständlichen, die Eigenschaft oder Bewegung des Dinges.
Indem der Dingcomplex in Verbindg mit mancherlei Eigenschaftscomplexen,
diese in Verbindg mit man̄igf Dingcomplexen wiederkehren, ergiebt
sich eine Möglichkeit, die Denkwege von diesen beiderlei Complexen
zum gewünschten Ding-Zustand gleichsam in allgemein giltiger Weise
u abgesehen von der jeweils realen W auszuarbeiten. Die
Denkarbeit mit Urtheilen anstatt mit einzelnen ungeordneten Wcomplexen
ist also eine große Ersparniß. Ob die so gewon̄ene psychol. Einheit
auch durch eine Neinheit im Denkablauf vertreten wird, und durch
eine andere als die Wortvorstellg, bleibe unerörtert.In die Urtheilsschöpfung kan̄ sich bereits der Irrthum eindrängen.
Die Ding- oder Beweggscomplexe sind nämlich nie ganz identisch
u unter den abweichenden Bestandtheilen können sich solche finden,S.
[98]
deren Vernachlässigg den Ausfall in der Realität stört. Dieser Mangel
des Denkens stam̄t aus dem Bestreben, das wir hier ja nachahmen,
dem Complex ein einzelnes N zu substituiren, wozu gerade die unge-
heure Complexität nötigt. Das sind Urteilstäuschgen oder Fehler der
Praemissen.
Ein anderer Grund des Irrthums kan̄ darin liegen, daß die W der Realität
nicht vollständig wahrgenomm̄en wurden, weil sie sich nicht im Sinnesbereich
befanden. Das sind Irrthümer der Ignoranz, allen Menschen
unvermeidlich. Wo diese Bedingg nicht zutrifft, kan̄ die psychische Vorbesetzg
mangelhaft sein (wegen Ablenkg des Ich von den W weg) u ungenaue
W u unvollständige Denkabläufe ergeben; das sind Irrthümer
durch mangelnde Aufmerksamkeit.
Nehmen wir jetzt als Material der Denkvorgänge die beurtheilten
u geordneten Complexe anstatt der naiven, so ergiebt sich eine
Gelegenheit den praktischen Denkvorgang selbst abzukürzen. Hat sich
nämlich ergeben, daß der Weg von W zur Identität mit der Wunsch-
besetzg über ein Beweggsbild M führt, so ist biologisch gesichert,
daß nach Eintreffen der Identität dieses M voll in̄erviert werde.
Durch die Gleichzeitigkeit der Wu dieses M entsteht eine intensive
Bahng zwischen beiden, u ein nächstes W wird das M ohne
weiteren Associationsablauf erwecken. Es ist dabei freilich angenom̄en
daß es jederzeit möglich ist, Verbindg zwischen 2Besetzgen herzustellen.Was ursprünglich eine mühselig hergestellte Denkverbindg war, wird
durch gleichzeitige Vollbesetzg dan̄ eine [¿¿¿¿] kräftige Bahnung
von der es sich nur fragt, ob sie sich stets1 über dem zuerst gefundenen
Wege vollzieht oder eine direktere Verbindg begehen kann. Es
scheint letzteres wahrscheinlicher, auch zweckmäßiger, weil es die
Nothwendigkeit erspart, Denkwege zu fixiren, die ja für die verschiedensten
anderen Verbindgen frei bleiben sollen. Fällt für den Denkweg
die Wiederholung weg, so ist auch keine Bahng von ihm zu erwarten
u das Resultat wird besser durch direkte Verbindg fixiert.
Allerdings, woher der neue Weg stam̄t, bleibt dahingestellt;
hätten beide Besetzgen, W und M, eine gemeinsame Association
mit einem Dritten, so wäre die Aufgabe erleichtert.Das Stück Denkablauf von der W bis zur Identität durch ein
M läßt sich auch herausheben u liefert ein ähnliches Ergebnis,
wenn dan̄ die Aufmerksamkeit das M fixiert u es in eine
Assosiation mit dem gleichfalls wieder fixirten W bringt.
Auch diese Denkbahng wird sich dan̄ im realen Falle wieder
einstellen.S.
[99]
Bei dieser Denkarbeit sind Irrthümer zunächst nicht einsichtlich, wol aber
kan̄ ein unzweckmäßiger Denkweg eingeschlagen und eine aufwandreiche
Bewegg herausgehoben werden, weil die Auswal beim praktischen
Denken doch nur von den reproducirbaren Erfahrungen abhängt.Mit dem Zuwachs an Erin̄ergen ergeben sich jedesmal neue Verschiebgswege.
Es wird darum vortheilhaft gefunden die einzelnen W vollständig
zu verfolgen, um unter allen Wegen die günstigsten auszufinden
und dieß ist die Arbeit des erkennenden Denkens, welches zw
als Vorbereig zum praktischen tritt, obwohl es sich thatsächlich erst
spät aus diesem entwickelt. Die Resultate desselben sind dan̄
für mehr als eine Art von Wunschbesetzg brauchbar.Die Irrthümer des erken̄enden Denkens liegen auf der Hand,
es sind die Parteilichkeit, wen̄ Zielbesetzgen nicht vermieden wurden
u die Unvollständigkeit, wen̄ nicht alle Wege begangen wurden.Es ist klar, daß es hier ein riesiger Vortheil ist, wen̄ gleichzeitig
Qz erweckt wurden, bei der Eintragung dieser herausgegriffenen
Denkvorgänge in den Erwartgszustand kann der Assocablauf
vom Anfangs- zum Endglied durch die Qualz anstatt über die
ganze Denkreihe zu gehen u dabei braucht die Qualreihe
nicht einmal vollzählig der Denkreihe zu entsprechen.Im theoretischen Denken spielt die Unlust keine Rolle, es ist
daher auch bei gebändigter Ermöglich.Wir haben noch eine Art des Denkens zu betrachten, das kritische
oder nachprüfende. Dieß ist dadurch veranlaßt, daß trotz Beachtg
aller [¿¿¿¿¿¿] Regeln der Erwartgsvorgang mit nachfspecifischer Aktion
anstatt zur Befriedigg zur [¿¿] Unlust führt. Das kritische
Denken sucht ohne praktisches Ziel in Muße und unter Wachrufg
aller Qualz den ganzen Qἠ ablauf zu wiederholen, um einen
Denkfehler oder einen psychol Mangel nachzuweisen. Es ist ein
erkennendes Denken mit gegebenem Objekt, einer Denkreihe
nämlich. Worin letztere bestehen können, haben wir gehört; worin
bestehen aber die logischen Fehler?Kurz gesagt, in der Nichtbeachtg der biologischen Regeln für den Denk-
ablauf. Diese Regeln besagen, wohin sich jedesmal die Aufmbesetzg
zu richten u wan̄ der Denkvorgang halt zu machen hat. Sie sind
durch Unlustdrohgen geschützt, aus Erfahrg gewon̄en u laßen sich
ohne Weiteres in die Regeln der Logik umsetzen, was im
Einzelnen zu erweisen sein wird. Die intellektuelle
des Widerspruches, bei der der prüfende Denkablauf halt
macht, ist also nichts anderes als die zum Schutz der biolog Regeln
aufgespeicherte, die durch den unrichtigen Denkvorgg rege gemacht wird.S.
[100]
Die Existenz solcher biologischer Regeln ist eben aus dem Unlustgefühl
bei logischen Fehlern zu erweisen.Das Handeln können wir uns nun aber nicht anders vorstellen ubw
als die Vollbesetzung jener Bewegungsbilder, die beim Denkvorgang hervor-
gehoben worden sindetwa dazu noch jener, welche (wen̄ Erwartgszustand
war) zum willkürl Antheil der specif. Aktion gehören. Hier ist
ein Verzicht auf den gebundenen Zustand, und eine Einziehg der Auf-
merkskeitsbesetzgen. Der erstere geht wol so vor sich, daß mit dem
ersten Ablauf von den motor N aus das Niveau im Ich unaufhaltsam
sinkt. Wol wird nicht eine complete Entladg des Ich bei einzelnen
Handlgen zu erwarten sein, sondern nur bei den Befriediggsakten
ausgiebigster Art. Die Handlg geschieht lehrreicherweise nicht durch
Inversion der Bahn, welche die Beweggsbilder gebracht hat, sondern
auf besonderen motorischen Wegen u der Beweggseffekt ist darum
nicht auch selbstverständlich der gewollte, wie er bei Inversion
derselben Bahn sein müßte. Es muß daher während der Handlung
eine neue Vergleichg der ankommenden Beweggsnachrichten mit den
vorbesetzten stattfinden und eine Erregg corrigirender Innervationen
bis Identität erreicht ist. Es wiederholt sich hier derselbe Fall, der
auf der Wseite stattfand, nur in geringerer Man̄igfaltigkeit
größerer Raschheit u beständiger voller Abfuhr, was dort ohne solche
geschah. Die Analogie ist aber bemerkenswert zwis. praktischem Denken
und zweckmäßigem Handeln. Man ersieht daraus, daß die Beweggsbilder
sensibel sind. Die Eigenthümlichkeit aber, daß beim Handeln
neue Wege eingeschlagen werden anstatt der soviel einfacheren
Inversion, scheint zu zeigen, daß die Leitgsrichtg der Nelemente
eine wol fixirte ist, ja vielleicht, daß die Nbewegg hier wie dort
andere Charactere haben kann.
Die Beweggsbilder sind W u haben als solche natürlich Qualität u erwecken
Bewußtsein; man kan̄ auch nicht bestreiten, daß sie mitunter große
Aufmerksamkeit auf sich ziehen; allein ihre Qualit sind wenig auffällig,
wahrscheinlich nicht so man̄igfaltig als die der Außenwelt und
sie sind nicht mit Wortvorst assocrt, dienen z. Th vielmehr
selbst dieser Association. Sie rühren aber nicht von hoch organisirten
Sinnesorganen her, ihre Qualität ist wol monoton.
OV 13 Box 39-16
Die Anmkerungen zum Impressum finden sich bei Teil 1 des Manuskipts des [Entwurfes einer Psychologie].